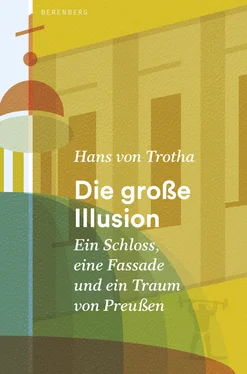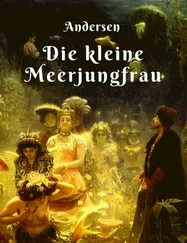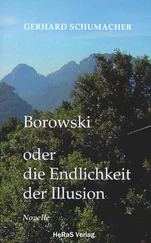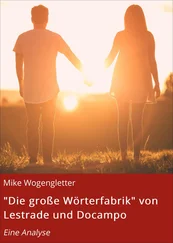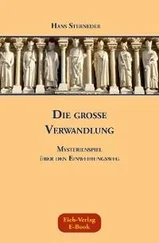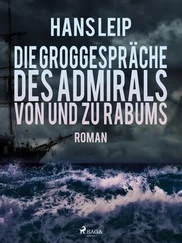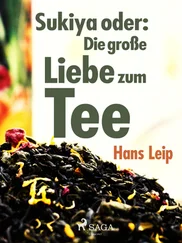»Das Kaiserreich«, kolportiert Conze die Clark-Debatten von 2014, »werde in ein schlechtes Licht gerückt, es werde als autoritär und aggressiv charakterisiert, um das Deutschland des 21. Jahrhunderts zu treffen und es an einer selbstbewussten nationalen Politik zu hindern. Die 2017 erstmals in den Bundestag gewählte AfD plädiert für eine Außenpolitik, die sich an Bismarck orientiert, und beklagt in einem Parlamentsantrag, dass die ›gewinnbringenden Seiten der deutschen Kolonialzeit erinnerungspolitisch keinen Niederschlag finden‹. Zugleich wird darüber gestritten, ob der deutsche Völkermord an den Herero und Nama in den Jahren 1904 bis 1908 Entschädigungsleistungen rechtfertigt. Auch der Umgang mit Kunst und Kultur aus kolonialen Kontexten ist umstritten. Das zeigt nicht zuletzt die Diskussion über das im wiedererrichteten Berliner Stadtschloss der Hohenzollern beheimatete Humboldt Forum und seine Ausstellung.«
Hier begegneten sich zum Zeitpunkt der Eröffnung des Berliner Humboldt Forums Ende 2020 zwei Debatten, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben wollten: die Debatte um die Ausstellung innerhalb des Gebäudes, also seine Nutzung, und die Debatte um die Fassade. Während beide Debatten neu belebt wurden und dabei an Profil und Schärfe gewannen, wuchs jene in Sandstein gemeißelte Projektionsfläche aus dem Kellergeschoss der deutschpreußischen Vergangenheit in die Höhe, von der hier die Rede sein soll.
Dass die erwähnten Debatten also vor der just in diesem Moment fertiggestellten Hohenzollern-Schloss-Fassade stattfinden, mag man einen Zufall nennen. Aber die Geschichte kennt die Kategorie des Zufalls nicht. Gleichzeitigkeiten kann man feststellen, oder man kann sie ignorieren – was sich am schnellsten und einfachsten, vor allem aber unter Vermeidung jeglichen argumentativen Aufwands erledigen lässt, indem man die Kategorie des Zufalls bemüht, dessen wesentliche Aufgabe ja gerade darin besteht, Zusammenhänge zu leugnen. Und dass man in diesem Fall die Debatte um die Funktion eines Gebäudes (und seine Botschaften) und die Debatte um seine Fassade (und deren Botschaften) voneinander trennen kann und sogar trennen soll, ist eine Besonderheit dieses Baus und der eigentliche Gegenstand dieses Essays.
Unmittelbar nach der in fast jeglicher Hinsicht – außer im Ergebnis eines geeinten Staates – vollkommen anders gearteten, neuerlichen Einigung zu einem zweiten deutschen Nationalstaat im Jahr 1990 kam in konservativen Kreisen der Gedanke auf, das im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte, nach Kriegsende notdürftig reparierte und dann im Jahr 1950 im Auftrag von Walter Ulbricht gesprengte Berliner Schloss (nicht Stadtschloss ) wieder aufzubauen. Die Idee war auch zu DDR-Zeiten schon ventiliert worden, damals allerdings mit wenig Hoffnung auf Realisierung. Der Fall der Mauer und die schnell folgende Einigung änderten diese Lage und gaben dem Traum von einem neuen Hohenzollern-Schloss inmitten einer neuen demokratischen Hauptstadt Auftrieb. Die Vereinigung war das Momentum, das die Protagonistinnen und Protagonisten eines Schloss-Neubaus für sich nutzen zu können meinten. Sie gaben sich der Illusion hin, auf diesem Weg architektonisch eine Wunde heilen zu können, die die unheilvolle Dynamik der Geschichte des 1871 gegründeten deutschen Reichs und ihre schwerwiegenden Konsequenzen der deutschen Nationalseele zugefügt hatten, tiefe narzisstische Kränkungen, die mit einer historisierenden Fassade natürlich so wenig geheilt werden können wie ein Bruch mit einem Pflaster. Aber, um im medizinischen Bild zu bleiben: Eine Prothese sollte die Amputation vergessen machen. So sehen es die Kritikerinnen und Kritiker. Die Befürworterinnen und Befürworter einer Schlossfassadenrekonstruktion halten die Operation offenbar für gelungen. Wobei noch nicht ganz geklärt ist, wie es dem Patienten geht. Genau besehen, gibt es zwei Patienten: die Institution Humboldt Forum, die sich hinter dieser Fassade formiert, und die Stadt.
Kontrafaktische Architektur
Da steht es, gewaltig, wirkt weniger wie Auferstanden aus Ruinen , also von unten aus dem geschichtsträchtigen Berliner Boden gewachsen, als wie gelandet, ein riesiges Raumschiff – zurück aus der Vergangenheit in die Zukunft. Es mutet fehl an an diesem Schlossplatz, der sein Schloss nicht mehr gewohnt ist. Und es teilt uns zunächst einmal mit, dass sich Zukunft auch anfühlen kann wie Vergangenheit. Gemeint ist es womöglich umgekehrt: dass nur in der Vergangenheit die Zukunft liegt? AKW Mitte , entfährt es einem Passanten, der es offenbar zum ersten Mal fertiggestellt vor sich sieht. Das ist vor allem despektierlich, aber es ist auch der spontane Ausdruck eines Befremdens, eines Erschreckens über die Massivität, eines Eingeschüchtertseins durch die Macht der abweisenden Fassade, ein Gefühl der Fremdheit, das nach spontaner Distanzierung verlangt.
Darauf immerhin wird man sich einigen können: Ein Zeichen des Aufbruchs ist diese Fassade nicht. Die erste Botschaft, die von ihr und damit von der Entscheidung ausgeht, sie in dieser Form zu errichten, ist die, dass wir unsere Gegenwart – und damit unsere Zukunft – architektonisch und städtebaulich nur mit Hilfe von Reminiszenzen an eine apodiktisch ernst genommene Vergangenheit gestaltet bekommen. Das wäre, würde es stimmen, ausgesprochen schmerzlich und sehr traurig. Dass es nicht ganz stimmt, zeigen spektakuläre Bauprojekte in anderen Städten, sei es die Tate Modern in London oder das Kulturzentrum der Stavros-Niarchos-Stiftung in Athen: moderne Treffpunkte von Kultur, Künsten, Menschen allen Alters, zeitgemäße Realisierungen der alten Idee der Agora, Orte der Gegenwart im Sinne des Aufbruchs – all das, was man sich an dem Ort, von dem hier die Rede ist, ebenfalls wünscht.
Hätte es nicht werden können, was das Centre Pompidou für Paris wurde (das zunächst auch äußerst umstritten war)? Warum ist die deutsche Antwort auf die Herausforderung einer Großkulturbaustelle ein »zum Humboldt Forum wiederaufgebautes Schloss« – zu dieser diplomatisch eleganten, wenn auch rhetorisch ins Leere laufenden Formulierung hat sich die entsprechende Wikipedia-Seite durchgerungen. Es tut ein bisschen weh, wenn man nachliest, wie Horst Bredekamp, einer der Gründungs-Intendanten des Humboldt Forums, rekapituliert, dass auf der Suche nach einer Nutzung für dieses riesige Gebäude hinter der historisierenden Fassade nach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Humboldt Universität als dritter Akteur Berlin hinzukam, »das mit seiner Stadtbibliothek ebenfalls Einzug in das Schloss halten sollte, um ein lebendiges Klima zu erzeugen, für welches das Pariser Centre Pompidou eine Art Vorbild war«.
Nun ist dem Gebäude in einem unauflösbaren Paradox die Aufgabe zugeteilt, den Wunsch, moderne Agora, Treffpunkt für alle, zukunftsweisende Stadtmitte zu sein, im Inneren zu erfüllen, während die das Haus nach außen repräsentierende Fassade einen ganz anderen Geist atmet und sich als Wiedergängerin einer autoritär-repressiven Staatsarchitektur (miss)verstehen lässt. Denn so sieht sie nun mal aus. Und die Erbauer sind ja gerade besonders stolz auf die detailgenaue Rekonstruktion. Das ist handwerklich fraglos eine große Leistung, bringt mit Blick auf die ausgesandten Botschaften der Fassade aber ebenso fraglos Probleme mit sich.
Die Fassadenrekonstruktion bedeutet zuallererst einen Blick zurück, und zwar relativ weit zurück, nämlich hinter beziehungsweise (historisch gesehen) vor all das, was nach 1871 hier und im Land passiert ist. Diese Fassade ist Ausdruck des Wunschs nach einem architektonischen, bei der Dimension des Gebäudes auch städtebaulichen reset , nach einer Wiederherstellung. Oder, wie es Wolfgang Thierse, ehemals Präsident des Deutschen Bundestages, Mitglied der Jury des architektonischen Wettbewerbs zum Berliner Schloss und glühender Befürworter der Fassadenrekonstruktion, im Jahr 2020 ausdrückte:
Читать дальше