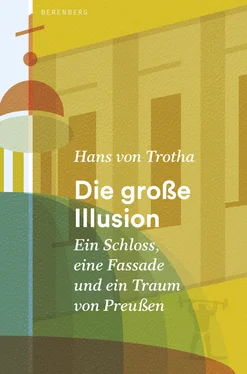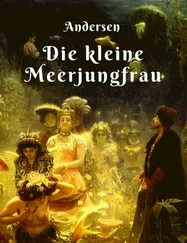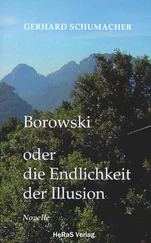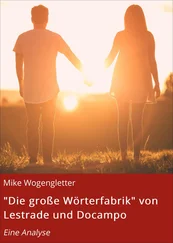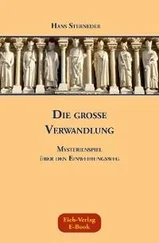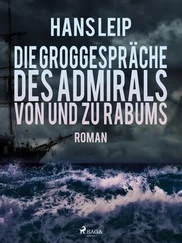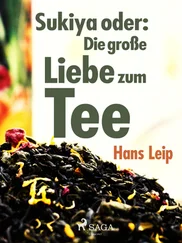Die Verkündung der Friedensbedingungen für das vernichtend geschlagene Deutschland ausgerechnet im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles bezog sich in einem Gestus triumphaler Revanche auf die Deklaration eines deutschen Nationalstaates an eben diesem Ort am 18. Januar 1871. Ein berühmtes Gemälde, das der Historienmaler Anton von Werner für den größten Saal im Berliner Schloss, den legendären Weißen Saal , auftragsgemäß anfertigte, hat die Szene in idealisierter Form festgehalten. Es ist zur Ikone des Ursprungs eines deutschen Nationalstaats geworden, der auf Betreiben und unter Führung Preußens entstand. Die Protagonisten gaben sich der Illusion hin, eine geeinte Nation könnte den Deutschen mehr Reichtum, mehr Einfluss und Macht, mehr Wohlstand, irgendwann – damit hatten sie es nicht ganz so eilig – vielleicht auch Frieden und ein gutes Leben unter den Bedingungen einer Moderne garantieren, deren umwälzende Veränderungen gerade spürbar zu werden begannen. Das Deutsche Reich, dessen Gründung Anton von Werners monumentales (4,34 mal 7,32 Meter) Gemälde im Berliner Schloss zelebrierte, sollte es nicht lang geben. Aus einem Krieg, dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71, war es hervorgegangen, in einem Krieg ging es auch zugrunde: 1918, am Ende jenes Kriegs, in dem Jean Renoirs La grande illusion spielt, war schon wieder Schluss mit dem Versuch, an das Heilige Römische Reich Deutscher Nation anzuknüpfen. Während Jean Renoir seinen Film schrieb und drehte, tobte innerhalb der deutschen Grenzen aufs Allerschlimmste gerade der sogenannte dritte Versuch.
Die erste und vordringlichste Botschaft der Fassade, um die es hier geht, ist die Aufforderung zu einem Blick in die Vergangenheit des Orts, an dem sie wiedererrichtet wurde, und des Gebäudes, zu dem sie früher gehörte. Es war das Residenzschloss der Könige von Preußen, nach der Einigung Deutschlands zum Nationalstaat 1871 der deutschen Kaiser.
Auch der Einigung zu einem deutschen Nationalstaat hat der Historiker Eckart Conze ein Buch gewidmet. Es erschien im Herbst 2020 mit Blick auf die 150. Wiederkehr der Reichsgründung im Januar 2021. Conze gab ihm den Titel Schatten des Kaiserreichs. Die Reichsgründung von 1871 und ihr schwieriges Erbe . Es schildert den Vorgang der Einigung Deutschlands und verfolgt die Debatten, die diese Einigung im Lauf der folgenden eineinhalb Jahrhunderte auslöste, geprägt von den und manchmal auch prägend für die politischen und gesellschaftlichen Fragen, die die Zeit jeweils bewegten. Dabei wird deutlich, dass diese Einigung, also die Einigung zum deutschen Kaiserreich in der Form, in der es nach 1871 real existierte, als »Kriegsgeburt«, als kleindeutsche Lösung (also ohne Österreich), als Revolution von oben, unter der Dominanz Preußens, gegen den Willen vieler Beteiligter (vor allem der süddeutschen Staaten), unter Ausschluss jedweder parlamentarischen Beteiligung, schließlich als autoritärer Zentralstaat alles andere als »alternativlos« war. Der Begriff, den Bundeskanzlerin Angela Merkel im Zusammenhang mit der Euro-Rettungs-Krise zur seither viel zitierten Chiffre dafür machte, dass es bisweilen unnötig sei, politisches Handeln logisch zu erklären und nachvollziehbar zu begründen (was bei der Namensfindung für eine rechte Fundamentalopposition, die Alternative für Deutschland , eine Rolle gespielt haben dürfte), fällt nicht nur bei Eckart Conze, sondern auch in anderen Darstellungen der Ereignisse von 1871, etwa in Christoph Jahrs ebenfalls im Herbst 2020 erschienenen Buch Blut und Eisen , dessen Untertitel die Rolle Preußens für die Reichseinigung von 1871 so fasst: Wie Preußen Deutschland erzwang . So anachronistisch die Anwendung des Begriffs alternativlos in seiner politischen Bedeutung von 2010 auf die komplexen politischen Verhältnisse im Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist, so kommt sie doch nicht von ungefähr: Hat doch eine nationalistische Geschichtsschreibung viel darangesetzt, das Gegenteil zu behaupten, also darzulegen, dass die Einigung Deutschlands unter der strammen Führung Preußens immer das Ziel der Geschichte gewesen sei – mithin also eben doch alternativlos .

Anton von Werner, Die Proklamation des deutschen Kaiserreichs. Fassung für das Berliner Schloss, enthüllt am 22. März 1877.
Öl auf Leinwand, 4,34 × 7,32 m, Kriegsverlust; nur als Schwarz-Weiß-Fotografie erhalten.
Eckart Conze erzählt die Geschichte der Einigung Deutschlands zum Kaiserreich nicht nur um ihrer selbst, sondern vor allem um der Konsequenzen willen, die sich aus ihr ergeben haben. Dabei hat er mit seinem Buch, das er eine »geschichtspolitische Intervention« nennt, eine Debatte innerhalb seiner Zunft ausgelöst, die auch in den Feuilletons ausgetragen wurde. Einerseits hatte das mit dem Jahrestag zu tun, der 150. Wiederkehr der Reichsgründung, die nicht zuletzt wegen Anton von Werners stets im Bildgedächtnis der Deutschen präsenten Gemälde immer gleich ein Bild erzeugt und damit verbunden Emotionen. Der lebhafte Streit um Conzes »Intervention« ist aber auch eine Folge davon, dass sich über eine intensive, zum Teil auch öffentlich diskutierte Beschäftigung mit dem 19. Jahrhundert, ein neues, differenziertes Bild des deutschen Kaiserreichs, des ersten Nationalstaats der Deutschen, ergeben hatte, immer wieder angeregt durch Jahrestage (etwa 100 Jahre Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Jahr 2014 oder 100 Jahre Frieden von Versailles im Jahr 2018, aber auch der 200. Geburtstag Otto von Bismarcks, des wichtigsten und umstrittensten deutschen Politikers im 19. Jahrhundert, ohne den es das deutsche Kaiserreich zu diesem Zeitpunkt und in dieser Form nicht gegeben hätte, im Jahr 2015).
Eckart Conze macht im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts in dem seit 1990 wieder zum Nationalstaat vereinten Deutschland eine »Renationalisierung, ja einen neuen Nationalismus« aus, »der außenpolitische Bindungen, nicht zuletzt in Europa, infrage stellt und innenpolitisch und gesellschaftlich einer völkisch bestimmten nationalen Identität das Wort redet«. Der Historiker spricht von »Dynamiken der Renationalisierung« und resümiert: »Unkritisch und offensiv bekennt sich ein neuer Nationalismus zur preußisch-deutschen Nationalgeschichte und stellt die Berliner Republik in ihre schwarz-weiß-rote Tradition.«
In verschiedenen Repliken wurde Conze vorgeworfen, die neuen Forschungsergebnisse zum 19. Jahrhundert nicht genügend zu würdigen und einseitig auf die »Schatten des Kaiserreichs« zu verweisen, ohne die gesellschaftlichen Fortschritte jener Epoche ausreichend zu berücksichtigen. So befand die Historikerin Birgit Aschmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung :
»Conzes Bild des Kaiserreichs folgt einer historiographischen Pendelbewegung, auf die er selbst eingeht. Hatte die deutsche Geschichtsschreibung bis in die fünfziger Jahre hinein ein weithin positives Bild der Jahre zwischen 1871 und 1914 gepflegt, das sich vom Nationalsozialismus und der ungeliebten Weimarer Zeit abhob, kehrte sich seit den sechziger Jahren mit den Thesen des Hamburger Historikers Fritz Fischer und der ›Bielefelder Schule‹ die Blickrichtung um. Fortan galten auch und gerade die gesellschaftlichen Strukturen des Kaiserreichs als ursächlich für den Ersten Weltkrieg und den Nationalsozialismus. In umfangreichen Forschungsprojekten versuchten Historiker nun, die Deformation des kaiserzeitlichen Bürgertums als Ursache der Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts dingfest zu machen. Letztlich aber scheiterte dieses Vorhaben, erwiesen sich doch das Kaiserreich als weniger undemokratisch und der Westen als weniger vorbildlich als gedacht. Fortan konzentrierte sich die Erklärung des Nationalsozialismus, erst recht des Holocausts, auf den Ersten Weltkrieg und Weimar, während die vom politisch-moralischen Erklärungszwang befreite Historiographie des neunzehnten Jahrhunderts ein vielschichtigeres Bild der deutschen Gesellschaft und Kultur entwickelte.« ( Frankfurter Allgemeine Zeitung , 9.1.2021)
Читать дальше