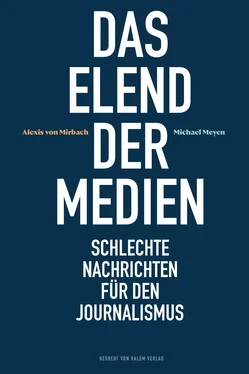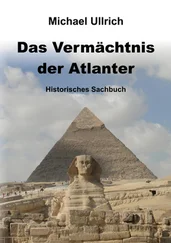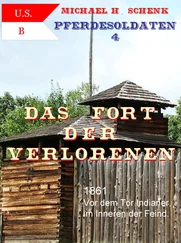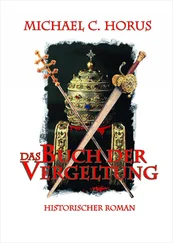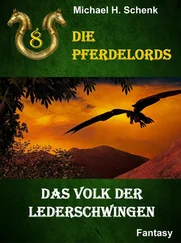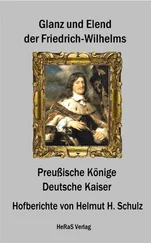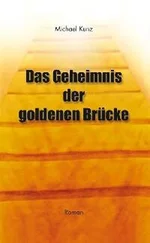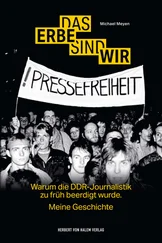Der ›Welt‹-Anspruch im Titel mag vermessen klingen, werden in La misère du monde doch nur Franzosen interviewt. Verwaltungsangestellte, Einwanderer, Polizisten, Familien in den Banlieus. Der Anspruch von Das Elend der Welt ist trotzdem global – weniger, weil ›monde‹ im Französischen auch einfach als ›Leute‹ verstanden werden kann, 7 sondern weil das Buch vor dem Hintergrund weltweiter Deregulierungen der Finanzmärkte, tiefgreifender Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt sowie umfassender Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens entstand. 8 Bourdieu selbst hat von einer »kollektiven Konversion zur neoliberalen Sichtweise […] im Schulterschluss mit den sozialistischen Parteiführern« gesprochen, 9 die in den 1990er-Jahren und 2000er-Jahren unter Bill Clinton, Tony Blair und Gerhard Schröder als Strategie »des dritten Weges« vorangetrieben wurde. 10
Im Elend der Welt zeigt sich die »Abdankung des Staates«: beim Wohnungsbau, bei der Überführung öffentlicher Dienstleistungen in den Privatsektor oder bei der Transformation schulischer Einrichtungen. Das alltägliche Leid spielt sich bei Mietern von Sozialwohnungen ab, deren Siedlungen zu Ghettos gemacht wurden, bei Einwanderern, denen das ethnische Stigma auf unauflösliche Weise in Hautfarbe und Namen eingeschrieben ist, 11 bei kleinen Beamten und Sozialarbeitern, die »die unerträglichsten Auswirkungen und Unzulänglichkeiten der Marktlogik kompensieren müssen«, 12 im Abstieg und Niedergang der alten Arbeiter, in ihrem Hass auf die neuen Vorarbeiter 13 oder bei Landwirten, denen die Frauen auf den Feldern fehlen, denen die Investitionen buchstäblich versickern und die (als das Mikrofon abgestellt ist) mit einem tiefen Seufzer ihre Sympathien für den Anführer der rechten Partei Front National gestehen. 14 Durch die Analyse der individuellen Situation gelingt es dem Forscherteam um Bourdieu, Entwicklungen von gesamtgesellschaftlicher Tragweite (und die Zukunft) zu erfassen.
Was hat das mit den Medien zu tun?
Ob Folge der von Bourdieu angeklagten neoliberalen Politik unter sozialdemokratischer Absolution oder nicht: Knapp drei Jahrzehnte nach La misère du monde steckt die Demokratie westlich-liberaler Prägung in der Krise. 15 Symptome sind nach herrschender Meinung das Erstarken autoritärer Regierungen in postsozialistischen Ländern, der Aufstieg der neuen Rechten, der Brexit oder Donald Trump. Nicht erst seit den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen ist die öffentliche Sorge um den Fortbestand der Demokratie auch in Deutschland zentraler Topos gesellschaftlicher Debatten. Der Soziologe Stephan Lessenich (um nur einen prominenten Sprecher zu zitieren) nennt als Indikatoren die »Eruptionen von Hass in sozialen Medien«, eine »sich leerlaufenden transmediale Aufregungsmaschine«, die »Unversöhnlichkeit des Umgangstons in der politischen Debatte« und eine bis ins Private vordringende »Dynamik des Kommunikationsabbruchs zwischen unvereinbar erscheinenden Meinungen.« 16
Dass die Krise der Demokratie auch eine Krise des Journalismus ist, hat Colin Crouch in seinem Konzept der »postdemokratischen Gesellschaft« 17 schon vor gut zwei Jahrzehnten herausgestellt. Während »Heerscharen von Wirtschaftslobbyisten« unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf den Hinterbühnen der Politik operieren würden, diene der »medienindustrielle Komplex« allein der Aufmerksamkeitsproduktion. 18 Dass in einer multioptionalen Welt, die Orientierung erwartet, aber nur komplexe Wahrheiten bietet, 19 die Krise als ›Normalzustand‹ 20 sehr viel mit Medien zu tun haben muss, zeigt allein die Inflation von Begriffen wie ›Fake News‹, ›Mainstream‹, ›Framing‹, ›Lügenpresse‹, ›Verschwörungstheorie‹ oder ›Desinformation‹. Deshalb der zweite Teil unseres Titels.
Unabhängig vom Titel gibt es in der Kommunikationswissenschaft mit der Media Malaise seit Ende der 1940er-Jahre die These, dass Medien die Ursache für negative Einstellungen gegenüber der Politik und demokratischen Prozessen sind: Paul Lazarsfeld und Robert Merton warnten vor einer »narkotisierenden Dysfunktion der Medien«, 21 und Michael Robinson führte in den 1970er-Jahren den wachsenden Zynismus gegenüber der Politik auf die Präsentationsformen des Fernsehens zurück und prägte das Schlagwort Videomalaise . 22 Video- und Media-Malaise-Forscher untersuchen seither, ob Skandalisierung, Negativismus, Konflikthaftigkeit oder Personalisierung für die steigende Politikverdrossenheit verantwortlich sind. 23
Auf großes Interesse stießen die Erkenntnisse aber weder in der Öffentlichkeit noch in den Redaktionen oder in der Politik. 24 Das dürfte auch an der Zielvariable Politikverdrossenheit gelegen haben. Lange hat man zwar das Sinken der Wahlbeteiligung vor laufenden Kameras mit Krokodilstränen beklagt, solche Symptome aber als Wohlstandsapathie ad acta gelegt, solange sich nicht abzeichnete, dass sich dahinter eine fundamentale Systemkritik verbergen könnte und möglicherweise eine Medienwirkung. 25
Ganz anders heute. Die PEGIDA-Demonstranten haben ihre Systemkritik ab 2014 über den Begriff ›Lügenpresse‹ transportiert. Und der Brexit sowie die Wahl Trumps zeigten wenig später, dass sich liberaldemokratische Verhältnisse tatsächlich ändern können, womöglich herbeigeführt durch einen Strukturwandel der Öffentlichkeit, der eng mit digitalen Plattformen wie Facebook oder Twitter zusammenhängt. Veränderungen der öffentlichen Kommunikation sind seither Chefsache in Politik, Journalismus und Wissenschaft – und damit auch die Frage, wer oder was das Elend in den Medien ist.
Wie aus Elend Zukunft wird
Das Elend sei »vielgesichtig«, schreibt Bourdieu, »unformuliert« und »unformulierbar«. Manchmal drücke es sich mangels legitimer Mittel nur in Hass oder Wahn aus. 26 Dieses Buch zeigt viele Gesichter des Elends der Medien. Wir sammeln schlechte Nachrichten für den Journalismus – gefunden bei Bürgern, Medienprofis am Rande des journalistischen Feldes und bei denen, die in der Nähe des Machtpols arbeiten und dennoch nicht nur Gutes zu sagen haben. Indem wir Medienkritik aus unterschiedlichen Feldpositionen in ihrer habituellen Verknüpfung darstellen, betreiben wir Ursachenforschung. Wo liegen die Wurzeln der Medien- und Demokratie-Malaise?
Für dieses Buch treiben uns ein Reformgedanke und der Glaube an den »transformativen Einfluss« von Wissen an. Mit Anthony Giddens gehen wir davon aus, dass Akteure (Medienmacher, Medienpolitiker, Mediennutzer) Strukturen (also Regeln für soziale Praktiken sowie Ressourcen) im Handeln nicht nur reproduzieren, sondern auch modifizieren können. 27 In der Strukturationstheorie ist die Veränderung gewissermaßen eingebaut – im Unterschied zur herkömmlichen Mediensystemforschung, die Strukturen wie die Mediengesetzgebung, Aufsichtsbehörden, die journalistische Berufsideologie oder soziale Tabus eher als restriktiv konzeptualisiert. 28 Bei Giddens schränkt Struktur Handeln nicht nur ein, sondern ermöglicht es auch ( Dualität von Struktur ). Außerdem (das ist für den Wunsch nach Reformen wichtig, der dieses Buch trägt) existiert Struktur nicht »unabhängig von dem Wissen, das die Akteure von ihrem Alltagshandeln haben«: »Handelnde wissen immer, was sie tun« – auch wenn dieses Wissen möglicherweise auf der Ebene des praktischen Bewusstseins bleibt, Grenzen hat (»uneingestandene Bedingungen und unbeabsichtigte Folgen des Handelns«) und auf der diskursiven Ebene keineswegs immer adäquate Entsprechungen findet. 29 Bourdieu formuliert das so: »Was die Gesellschaft hervorgebracht hat, kann die Sozialwelt mit einem solchen Wissen gerüstet auch wieder abschaffen.« 30 In Kurzform: Wir müssen ein Bewusstsein für Missstände schaffen, um das Negative im Sinne des Friedensforschers Robert C. Jungk 31 sowie des US-Soziologen Erik Olin Wrights in »reale Utopien« 32 zu verwandeln.
Читать дальше