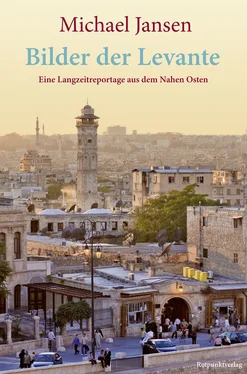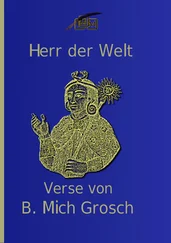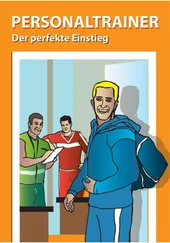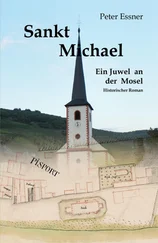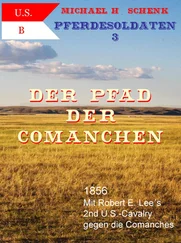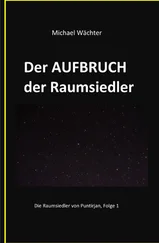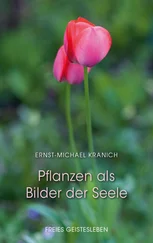Bay City, Michigan, USA, vierziger Jahre
Grandma Fancher erlaubte nur ein paar leichte Möbelstücke auf ihrem Saruk; Schuhe waren verboten. Aber sie hatte nichts dagegen, wenn ich mit meinem Spielzeugauto über die blau geblümte Fahrbahn entlang des Teppichrands fuhr. Der Saruk ist viel herumgekommen. In Iran geknüpft, in Bay City erstanden, nach Denver und wieder zurück transportiert, dann nach Beirut, Damaskus und schließlich in das zweitausend Jahre alte Agios Dometios, die Mischung aus Vorort und Dorf, wo ich heute wohne.
Grandma Fancher bewohnte eine Zimmerflucht in dem schönen Haus mit Garten ihrer Schwester Minnie. Der Saruk bedeckte die Holzdielen im Salon meiner Großmutter, um ihr Bett im Nebenzimmer waren drei blaue chinesische Seidenteppiche gelegt. Auf ihrem Frisiertischchen ein silbernes Art-Déco-Set, Handspiegel, Kamm und Bürste, verziert mit einer Frau mit fließendem Haar. Grandma Fancher frühstückte im Bett, saß dort in ihrer wattierten Jacke, das Essen vor sich auf einem Tablett mit Füßchen, von der Köchin hereingebracht. In der rechten oberen Ecke des Tabletts stand immer eine kleine Teekanne mit Blumenmuster, dazu die passende Tasse und Untertasse. Über Nacht hatte ihr ein spinnenfeines Haarnetz eine zarte Linie quer über die Stirn gezeichnet. Nachdem sie gebadet, sich mit Talkumpuder eingerieben und angekleidet hatte, frisierte sie sich mit einem elektrischen Lockenstab das drahtige graue Haar, das sie kurz, aber nicht zu kurz trug.
Grandma Fancher, eine zierliche Frau mit dunklen, tief liegenden Augen, stets in elegante, dunkelblaue oder burgunderrote Kleider aus weicher Wolle gekleidet, eine Brosche am hohen V-Ausschnitt, sah ihrer großgewachsenen, knochigen, hellhäutigen älteren Schwester überhaupt nicht ähnlich.
Vor dem Mittagessen zog der Duft von Hefebrötchen und Brathähnchen durchs Haus. Bei Tisch musste ich stillsitzen und aufessen. Die Ehre meines Zweigs der Familie – der jüngeren, benachteiligten Seite – lag auf meinen Schultern. Der Zweig von Großtante Minnie war die wohlhabende, ältere Seite.
Ida, meine Großmutter, hatte die High School als Jahrgangsbeste abgeschlossen und wollte gern ans Vassar College, doch ihr Vater, der dafür wohlhabend genug gewesen wäre, sagte: »Mädchen gehen nicht aufs College, sie heiraten.« Ida rächte sich, indem sie ihrer Schwester Minnie den Verlobten stahl. Auf Idas Nachttischchen stand in einem Silberrahmen ein Foto vom großen, ernsten Arthur und ihr selbst, in Weiß, breitkrempige Hüte auf den Köpfen, während eines Urlaubs in Palm Beach.
Sie hatte immer nach Hawaii gewollt. Arthur versprach es ihr, starb aber in Denver, bevor sie die Reise hätten antreten können. Mit meinen Eltern kehrte sie nach Bay City zurück, um sich dort im Netz der Familie zu verfangen, breit ausgeworfen von der auch verwitweten Minnie.
Ich rechne es Grandma Fancher hoch an, die Grundlagen für meinen Triumph mit dem Heiligen Ludwig gelegt zu haben. In goldenen Brokat gekleidet, saß sie in der Wohnung meines Vaters im Ohrensessel und las mir aus den Märchen der Gebrüder Grimm und Hans Christian Andersen vor, bis ich sie auswendig kannte und sich die Worte klammheimlich in mein Unbewusstes eingeprägt hatten. Als ich dann gedruckten Worten in der Geschichte über den Heiligen Ludwig begegnete, sprangen sie mich praktisch aus den Seiten an.
Bay City, Michigan, USA, September 1951
Der blasse Lehrer, unsere erste männliche Lehrkraft in der Grundschule, war neu und kannte sich in der Schule noch nicht aus. Als er die Anwesenheitsliste durchging, »Billie Carlisle« rief und ein Mädchen aufstand, wirkte er kurz ratlos. Sagte aber nichts. Als dann bei »Michael Fancher« ein zweites Mädchen aufstand, schickte er uns beide zur Direktorin. Die gute Seele brachte uns zurück ins Klassenzimmer und erklärte, dass diese Männernamen tatsächlich unsere seien. Er hätte wissen können, dass Billie durchaus als Mädchenname verwendet wird, bei Michael hätte er zugegebenermaßen mit einem Jungen rechnen können. Nach diesem kleinen Intermezzo fragte er mich nie, warum man mich so genannt hatte.
Gefragt haben mich das viele Leute, aber eine zufriedenstellende Antwort habe auch ich nicht. Stimmungsabhängig sagte Ma manchmal: »Dein Vater mochte keine Mädchennamen«, oder sie selbst habe sich für den Vornamen von »Michael Strange« entschieden, dem Pseudonym und Lieblingsnamen von Blanche Oelrichs, einer gefeierten Schauspielerin und Dichterin (von der meine Mutter vorgab, sie zu kennen). Blanche oder Michael war die zweite Ehefrau des Schauspielers John Barrymore; er wiederum war der zweite ihrer drei Ehemänner. Ihre Biografie Who Tells Me True erschien 1940, in meinem Geburtsjahr. Das mag sich auf meine Namensgebung ausgewirkt haben.
Oder Ma sagte, sie liebe Michael Arlens Der grüne Hut , einen gewagten Roman, der sowohl in New York und London für die Bühne bearbeitet als auch mit Greta Garbo und John Gilbert verfilmt worden war. Wie Blanche fühle ich mich wohl mit »Michael« und finde, der Name passt zu mir, auch wenn er hin und wieder für Verwirrung sorgt. Ein paar Wochen, nachdem ich angefangen hatte, für die Irish Times zu schreiben, erzählte mir ein Diplomat, im irischen Außenministerium gehöre es zum Insiderwissen, dass Michael Jansen eine Frau sei.
Beirut, Libanon, April 1965
Während unserer anfänglichen Telefonate wegen eines Jobs hatte Godfrey mich »Miss F.« genannt. Bei unserer wichtigsten Begegnung musste er im Bett liegen. Bei einem Besuch von Freunden im Bergdorf Schemlan hatte er eine schwere Kiste Lebensmittel vom Auto ins Haus getragen und einen Bandscheibenvorfall gehabt. Er hatte mir gesagt, der Haustürschlüssel liege unter dem Fußabtreter. Ich solle einfach in die Wohnung und ins Schlafzimmer kommen, dort liege er seit sechs Monaten. Der Professor, der mich für die Stelle als Redaktionsassistentin vorgeschlagen hatte, warnte mich vor dem Bewerbungsgespräch: »Jansen ist ein riesiger bärtiger Sikh, der kleine Mädchen frisst.« Unsicher, ob das nun ein Scherz war oder nicht, postierte ich meinen kräftigen syrischen Freund an der Haustür.
Godfrey war natürlich kein großer, bärtiger Sikh, der kleine Mädchen fraß, ob morgens, mittags oder zum Nachmittagstee. Er war ein schmaler Mann mit klar indischen oder südasiatischen Gesichtszügen, einer Hornbrille, leicht gewelltem schwarzem Haar und einer etwas gebieterischen Art. »Gehen Sie mal in die Küche und machen uns zwei Whisky«, befahl er. Ich tat wie mir geheißen, kam wieder zurück, setzte mich in den Besucherstuhl und wir besprachen, wie man das Middle East Forum von einer sporadischen monatlichen Zeitschrift zu einem ernsthaften, viermal jährlich erscheinenden Journal machen könne.
Die Arbeit musste warten, bis sein Arzt entschied, ob Godfrey geheilt war oder noch eine riskante Operation benötigte. Ich wollte gern anfangen, weil ich das Geld brauchte, und so rief ich ihn ab und zu an, um mich nach seiner Genesung zu erkundigen. Schließlich ging er für irgendwelche Untersuchungen ins Krankenhaus. »Die haben mich auf einen Tisch geschnallt, mir Kontrastmittel in die Wirbelsäule injiziert, mich in einem dunklen Raum auf den Kopf gestellt und geröntgt. Ich war da ziemlich lange drin, bis Suhail irgendwann reinkam und gesagt hat: ›Die Bandscheibe ist verheilt, aber weil die Nerven noch gereizt sind, musst du Krankengymnastik machen.‹ Als ich fragte, welche Farbe das Kontrastmittel denn habe, zog er die Spritze raus und hielt sie hoch. ›Schau, farblos.‹ Der Tisch wurde wieder zurück gekippt, ich wurde befreit und durfte nach Hause.« Gegenüber der Sache mit dem Kontrastmittel hatte ich meine Zweifel, sagte aber nichts.
Godfrey war die ideale Person für die ehrenamtliche Herausgabe des Journals. Als indischer Presseattaché in Kairo, Beirut und Istanbul war er seit 1948 immer wieder durch den Nahen Osten gereist. Er verfügte über ein breites Netzwerk in der Region und ein tiefes Verständnis, wie sie wirtschaftlich und politisch funktionierte. Wenngleich er auf seinen Reisen Artikel in Auftrag geben wollte, schickte er bald mich nach Kairo auf die Suche nach Autoren.
Читать дальше