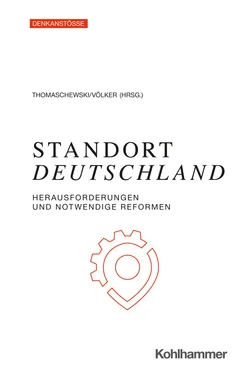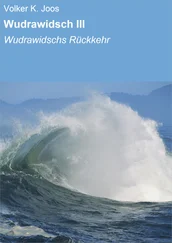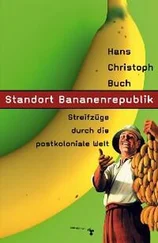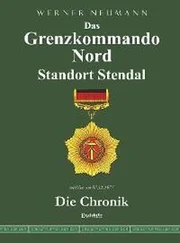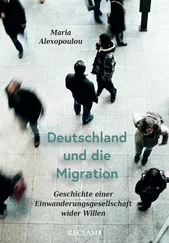Insbesondere in Städten verdichten sich die Herausforderungen durch den Klimawandel, Mangel an Wohnraum und Verknappung von Ressourcen. Es bedarf einer Neugestaltung des öffentlichen Raums weg von der autozentrierten hin zur menschenzentrierten Stadt. Daher führt der Weg in Richtung fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte sowie vernetzter Mobilitätsangebote, um Raum zu schaffen und die Lebensqualität (z. B. durch saubere Luft) zu erhöhen. Städte ziehen Menschen an und stoßen Autos ab. Dieser globale Trend wird verzögert gegenüber anderen Ländern auch in Deutschland sichtbar werden, indem Autos zunehmend aus den Städten hinausgedrängt werden (z. B. durch Verkehrsbeschränkungen, Parkraumbewirtschaftung, Fahrverbote, autofreie Innenstädte).
Auch multimodale Lösungen, um eine Reise komfortabel über mehrere Verkehrsträger hinweg zu ermöglichen, werden zunehmend, insbesondere bei jüngeren Generationen, nachgefragt. Im ländlichen Raum könnten in Ermangelung flächendeckender ÖPNV-Angebote zusehends Angebote autonomer und geteilter Mobilität entstehen. Pandemiebedingt erleben wir gerade, dass der öffentliche Nah- und Fernverkehr einer generellen Reform bedarf, um in der Breite der Bevölkerung als attraktive Option wahrgenommen zu werden. Um dies zu realisieren ist die Digitalisierung ein entscheidender Hebel (Echzeitinformationen, Planbarkeit, Abrechnungssysteme).
Insgesamt bewegt sich die Mobilität in einem soziokulturellen Paradigmenwechsel weg vom autozentristischen hin zu einem eher polyzentristischen Weltbild mit vielfältigeren Mobilitätsmustern als wir es heute gewohnt sind. Menschen werden zunehmend erfahren, dass ein Leben ohne eigenes Auto möglich ist. Dies funktioniert aber nur, wenn attraktive Alternativen vorhanden sind.
Agrarwirtschaft, Nahrungsmittelindustrie und Verbraucher sind gleichermaßen gefragt, wenn es darum geht, den negativen Eintrag für Umwelt und Klima zu reduzieren.
Systemisch bleibt in Europa weiterhin eine nachhaltige Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik notwendig. Gegenwärtig sehen wir immer noch eine starke Förderung der alten Systemstruktur mit dem Kern der industriellen Landwirtschaft, die wegen Palmölplantagen oder Viehzuchtfarmen Haupttreiber des weltweiten Waldverlustes ist. Die »Farm to Fork Strategy« der EU-Kommission als Teil des European Green Deals ist ein richtiger Ansatz für den Umstieg in ein faires, nachhaltiges und gesundes Ernährungssystem. Ähnlich wie im Energie- und Mobilitätssektor stehen aber viele Gewinner des derzeitigen Systems unter enormen Anpassungsdruck und werden weiterhin versuchen, die Transformation zu verzögern.
Im Blickfeld stehen sowohl die Nahrungsmittelerzeugung als auch der Nahrungsmittelkonsum. Erzeugerseitig ist die Hinwendung zu einer nachhaltigen Landwirtschaft unumgänglich, entsprechende Anreize müssen schnell gesetzt werden. Dies beinhaltet u. a. eine organische Landwirtschaft mit alternativen Düngemitteln und nicht-chemischem Pflanzenschutz, aber auch der systemische Umstieg von Monokulturen auf Mischkulturen und der gezielte Einsatz digitaler Applikationen, um den Einsatz von Pflanzenschutz und Wasser effizienter zu gestalten. Auch neue Konzepte der urbanen Landwirtschaft (Vertical Farming, Indoor Farming), sowie regionale und lokale Nahrungsketten (u. a. verbesserter Transport und Lagerung von Lebensmitteln) helfen strukturell, negative Umwelteinträge zu vermeiden. Biotechnologische Innovationen wie z. B. in der Saatgutentwicklung sind zwar ein umstrittenes Thema, werden aber gerade in der globalen Nahrungsmittelversorgung eine bedeutendere Rolle spielen.
Konsumseitig stehen veränderte Ernährungsgewohnheiten im Zentrum der notwendigen Reformen. An erster Stelle steht dabei ein reduzierter Fleischkonsum mit deutlichen Effekten für Klimaschutz und Naturverbrauch. Gleiches gilt im Übrigen auch für den Konsum von Palmöl oder Avocados, die als SUVs auf der Speisekarte bezeichnet werden können. Wichtig sind daher regionale und saisonale Nahrungsmittel, um auch Transporte und den Verlust von Nahrungsmitteln zu minimieren. Auch die digitale Unterstützung durch personalisierte Ernährungspläne kann dazu beitragen, das Einkaufen und Kochen von Lebensmitteln zu optimieren und geringere Mengen wegzuwerfen.
Vielfach unbeachtet durch die disruptiven Entwicklungen der Digitalisierung findet auf der Ebene der Materialien eine grundlegende Transformation statt, die als wichtiger Baustein einer nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise zu sehen ist.
Der vorherrschende Rohstoff in der chemischen Industrie ist immer noch Öl, das als Nebenprodukt aus den Prozessen der Ölraffinerien zur Entwicklung von Kraftstoffen verwendet wird. Notwendig ist zukünftig die verstärkte Verwendung von recycelten oder anderen nachhaltigen Materialien, die zu ihrer Herstellung keine fossilen Ressourcen benötigen. Den Gedanken der Kreislaufwirtschaft verfolgend müssen chemische Produkte im Hinblick auf ihren gesamten Lebenszyklus optimiert werden, einschließlich der Recyclingfähigkeit und biologischen Abbaubarkeit. Gleichfalls werden die zukünftigen Materialien spezifischere Eigenschaften ausweisen, insofern kann der Schadstoffeintrag und insbesondere das Gesundheitsrisiko in vielen Fällen reduziert werden. Der Green Deal der EU beinhaltet eine Strategie für eine echte Chemiewende, indem Innovationen für sichere und nachhaltige Chemikalien gefördert werden, um Umwelt und Menschen zu schützen.
Auch im Bauwesen sind materialseitig deutliche Verschiebungen absehbar. Entscheidend sind vor allem neue Verfahren zur Herstellung von grünem Zement oder Stahl. Vielfältige Forschungen legen nahe, dass in den nächsten Jahrzehnten eine klimaneutrale Produktion möglich wird. Bei Zement betrifft dies einerseits eine neue chemische Zusammensetzung und andererseits die Verpressung von Kohlendioxid. Beim Stahl erfolgt der Weg über die Nutzung von grünem Wasserstoff als Energieträger, was dem Thema generell zum Durchbruch verhelfen soll. Aber auch das Recycling von Materialien wird eine bedeutende Rolle einnehmen und zirkuläre Prozesse in der Bauwirtschaft stimulieren.
4.5 Zeigen, dass es geht!
Die ökonomischen Chancen, die in der nachhaltigen Transformation vieler Märkte liegen, dürfen aber nicht überlagern, dass es einen starken politischen Impuls geben muss, diesen Umbruch unumkehrbar zu machen. Derzeit gehen die EU und China voran und streben bis 2050 bzw. 2060 die vollständige Klimaneutralität an. In der EU gibt es mit dem Green Deal bereits ein nahezu verbindliches Maßnahmenprogramm, während in China die Absichtserklärung noch mit konkreten Bestandteilen unterlegt werden muss. Man darf gespannt sein, ob die USA sich wieder in das globale Klimaregime eingliedern und entsprechende Zielsetzungen verbindlich formulieren. Aus globaler Sicht ist es wichtig, dass die Sustainable Development Goals der UN als handlungsleitete Prinzipien gelten und das Paris-Abkommen verbindlich umgesetzt wird.
Zeigen wir in Europa, dass es geht und warten nicht wie das Kaninchen vor der Schlange auf China oder die USA. Der Green Deal ist ein mutiger Schritt, der hoffentlich auch zur Umsetzung kommt, insbesondere auch um den langfristigen Wohlstand zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Der Fokus auf die genannten Bereiche von Energie bis zum Bauen ist richtig, kann aber durch vielfältige Maßnahmen begleitet werden: z. B. die strikte Ausrichtung des öffentlichen Beschaffungswesens auf Nachhaltigkeit oder die vermehrte Internalisierung externer Umweltkosten, um der Natur den Wert beizumessen, den sie verdient hat. Dabei ist zu beachten, soziale Ausgleichsmaßnahmen in der Gesellschaft für negativ Betroffene zielgerichtet zu adressieren. Sicher wird dies in den kommenden Jahren auch eine Debatte über Universal Basic Services als Instrument der öffentlichen Daseinsfürsorge befeuern. Welche Güter müssen dem Gemeinwesen zur Verfügung gestellt werden?
Читать дальше