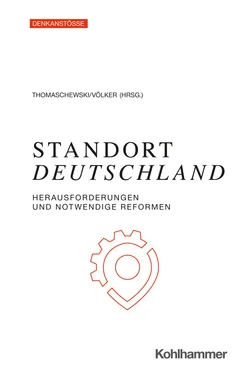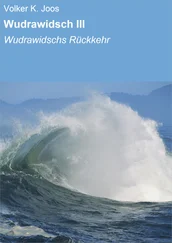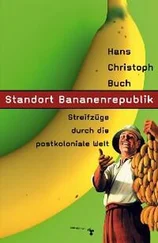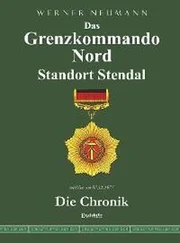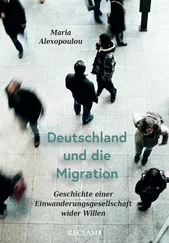4.2 Vom Wissen und Reden zum Handeln
Die Geburtsstunde der Umwelt-, Ressourcen- und Klimaberichte fällt auf die Veröffentlichung der ersten Club of Rome-Studie »Die Grenzen des Wachstums« aus dem Jahr 1972. 50 Jahre später ist einerseits viel passiert, was die Verbesserung der Umwelt betrifft, aber eben andererseits Vieles und vermutlich ein Vielfaches, das den Zustand der Erde hinsichtlich der natürlichen Lebensgrundlagen als kritisch zu bezeichnen erlaubt. Erich Fromm schrieb 1979 in seinem Werk ›Haben oder Sein‹: »Während im Privatleben nur ein Wahnsinniger bei der Bedrohung seiner gesamten Existenz untätig bleiben würde, unternehmen die für das öffentliche Wohl Verantwortlichen praktisch nichts, und diejenigen, die sich ihnen anvertraut haben, lassen sie gewähren.« Im Kern ist darin die zentrale Position der in der jungen Bewegung »Fridays for Future« Engagierten zum Ausdruck gebracht. Sprich, das Wissen um die anstehende Bedrohung ist seit vielen Jahrzehnten bekannt, aber ein entsprechendes Handeln lässt in vielen Teilen auf sich warten.
Der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) wurde bereits 1988 gegründet, der Gipfel von Rio 1992 über Umwelt und Entwicklung sowie die UN-Klimakonferenz von 1995 stellen zwei weitere Startschüsse in die internationale Auseinandersetzung über Nachhaltigkeit und Klima dar. Insbesondere im Jahr 2015 schienen mit der Verabschiedung der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) als politische Zielsetzung für eine ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit im Jahr 2030 und dem Paris-Abkommen mit verbindlichen Klimazielen zur Begrenzung der Erwärmung auf weniger als 2 Grad Celsius bis 2100 gegenüber der vorindustriellen Zeit, Durchbrüche in Richtung Nachhaltigkeit auf globaler Ebene bevorzustehen. Allerdings fehlt es gegenwärtig immer noch an global konzertierten Aktionen, die auch nationale, regionale und lokale Entscheidungsträger in Verantwortung nehmen, um die adressierten Ziele endlich verbindlich umzusetzen. Umso wichtiger ist es, dass die Entscheidungsträgerinnen und -träger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein schnelles Umsteuern bewirken.
Forschungen und Studien zu den sich anbahnenden neuen planetaren Belastungsgrenzen (u. a. Klima, Ozeane, Atmosphäre) und diversen ökologischen Kipppunkten (Schwinden der Eiskörper, Veränderung von Strömungssystemen und Eingriffe in artenreiche Ökosysteme) sind zahlreich vorhanden. Dabei sind die vielfältigen Wechselwirkungen noch nicht in Gänze durchleuchtet. Nahezu gesichert gilt aber, dass es wechselseitig zu selbstverstärkenden Prozessen kommen kann, die zu einem nicht benennbaren Zeitpunkt in der Zukunft unumkehrbar sind (vgl. u. a. Lade et al., 2020).
Nicht umsonst lauten die Schlagzeilen immer noch »The decade to deliver« (vgl. UN Global Compact CEO Study on Sustainability, 2019) oder »Humanity stands at a crossroads« (vgl. UN Global Biodiversity Outlook 5, 2020), wenn der gegenwärtige Zustand der Welt mit Blick in die Zukunft bezeichnet werden soll. Wir müssen vom Diskutieren ins Tun kommen! Die drei zentralen Handlungsfelder Klima, Biodiversität und Ressourcen sollen kurz beleuchtet werden.
4.2.1 Voranschreitender Klimawandel
Wir haben genug Wissen über die bestehenden Verhältnisse und anstehenden Entwicklungen durch die zunehmende Freisetzung von CO 2-Emissionen. Erderwärmung, Schmelzen der Polkappen und Auftauen des Permafrosts, Hitzewellen mit Dürren, Starkregen und Stürme, Anstieg des Meeresspiegels – die Fakten liegen auf dem Tisch. Heutige Interventionen und Maßnahmen werden jedoch erst nach Jahrzehnten auf ihre Wirksamkeit überprüft werden können, wodurch immer noch ein Legitimations- und Akzeptanzproblem besteht, ob diese dann tatsächlich heute schon notwendig sind. Hinzu gesellen sich beharrliche Kräfte in vielen Institutionen und Organisationen, die immer noch alte Klientelpolitik betreiben und das Ausmaß der Risiken nicht verstehen oder nicht wahrhaben wollen. Ausschlaggebend ist also der fehlende politische Wille, eine den Erkenntnissen entsprechende politische Agenda, wie sie im Paris-Abkommen angelegt ist, zu liefern. Es bedarf daher ambitionierter Partnerschaften zwischen entwickelten und sich entwickelnden Ländern, die durch politische Umsetzungsregeln, Handels- und Finanzierungsabkommen, technischer und sozialer Innovationskooperationen ausgedrückt werden müssen.
4.2.2 Übernutzung der Natur
Die gegenwärtige Pandemie führt uns plakativ vor Augen, welche Gefahren mit dem stetigen Zurückdrängen der natürlichen Lebensräume von Tieren und Pflanzen auftreten. Die Übernutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen wird sinnbildlich durch den Earth Overshoot Day ausgedrückt, den Tag im Jahr, an dem die Menschheit die verfügbaren Ressourcen auf der Erde, die im Laufe eines Jahres nachwachsen könnten, verbraucht hat. 1987 fiel dieser Tag noch auf den 19. Dezember, 2019 hingegen auf den 29. Juli (2020 pandemiebedingt auf den 22. August). Gegenwärtig verbrauchen wir daher 1,75 Planeten (Referenzjahr 2019). Würden alle weltweit so konsumieren wie die Menschen in den USA, wären sogar fünf Planeten notwendig, drei Planeten bei einem Verbrauch wie in Deutschland und 2,2 Planeten wie in China (vgl. https://data.footprintnetwork.org). Der gegenwärtige Ressourcenabbau für die industrielle Produktionsweise, die enorme Landnutzung (u. a. Abholzung der Regenwälder) und die Schadstoffeinträge in die Umwelt (Emissionen, Plastik etc.) sind in der gegenwärtigen Dimension für die Natur nicht mehr zu absorbieren. Neue Produktions- und Konsumformen (z. B. Kreislaufwirtschaft und regionale/ lokale Wertschöpfung), die Umgestaltung globaler Lieferketten und Innovationen in der Materialtechnologie sind weitere wichtige Hebel auf dem Weg zu einem gesünderen Planeten.
4.2.3 Verlust der Biodiversität
Erkenntnisse des Weltbiodiversitätsrates (IPBES) legen nahe, dass mit dem Schutz der Biodiversität eine ähnliche Herkulesaufgabe wie die Bewältigung des Klimawandels bevorsteht. Weltweit scheint es ein erwachendes Bewusstsein für die Aufgaben zu geben. Aber wieder sind die entsprechenden Handlungen noch weit vom Notwendigen entfernt. Ziele, die man 2010 formulierte, wurden ausnahmslos bis 2020 nicht erreicht, wenn es auch Fortschritte in einzelnen Bereichen gab. Werden die bestehenden Trends aber nicht gebrochen, ist der Ausblick in die Zukunft kritisch bis dramatisch einzuschätzen. Die zunehmende Landnutzung und der damit verbundene Verlust an Arten und Ökosystemen wird vielfältige negative Effekte insbesondere auf die globale Ernährungs- aber auch auf die Gesundheitssituation haben. Betroffen sind dabei vermutlich vor allem die heute schon ärmeren und vulnerablen Bevölkerungsgruppen, aber die gegenwärtige Pandemie lehrt uns, dass weltweite Konsequenzen, somit auch in Europa und Deutschland zu erwarten sind. Notwendig sind also ein intensiverer Schutz bestehender Ökosysteme, aber auch die Wiederbelebung von bedrohten Lebensräumen wie z. B. Wiederaufforstung von Regen- und Mangrovenwäldern oder die Beseitigung der Verschmutzung von Ozeanen und die Wiederherstellung von Korallenriffen.
4.3 Die Grundsatzfrage und der Zukunftsimperativ
Die Probleme sind also offenkundig wie virulent. Die führenden Volkswirtschaften stehen zweifelsfrei besonders in der Pflicht, auf ein Umsteuern ihrer Lebens- und Wirtschaftsweise hinzuwirken. Was ist aber der richtige Ansatz, um zu handeln? Die Diskussion speist sich entlang der Frage, ob das natürliche Kapital in Form von Ressourcen durch ökonomisches und soziales Kapital ersetzt werden kann oder nicht. In der Fachwelt spricht man von Weak Sustainability (schwache Nachhaltigkeit) versus Strong Sustainability (starke Nachhaltigkeit) (vgl. Ekin et al. 2003). Nachhaltigkeit wird oftmals mit drei Säulen erklärt – dem Ökologischen, dem Ökonomischen und dem Sozialen. Alle drei sind nach dieser Auffassung gleichwertig und dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden ( 
Abb. 7 Abb. 7: Das propagierte Modell der Nachhaltigkeit Dieses Prinzip bildet seit Jahrzehnten die herrschende Meinung unter den Entscheidungsträgerinnen und -trägern und ist als Ausdruck der schwachen Nachhaltigkeit zu sehen. Es basiert vor allem auf dem Glauben, dass die jeweils gegenwärtigen und zukünftigen ökologischen und sozialen Probleme durch neue technologische und ökonomische Lösungen überwindbar sind. Zu konstatieren ist jedoch, dass dieser Ansatz bisher dem Prinzip der Nachhaltigkeit unter ökologischen Gesichtspunkten nur unzureichend zu einer durchdringenden Wirkung verholfen hat. Vielmehr wird das gegenwärtige Modell durch die Abbildung 8 wiedergegeben. Demgegenüber rüttelt die starke Nachhaltigkeit am Kern des heutigen kapitalistischen Systems mit seinen effizienzgetriebenen und technikorientierten Paradigmen. Das Konzept der starken Nachhaltigkeit akzeptiert die planetaren Grenzen und möglichen Kipppunkte der Ökosysteme und legt damit auch den Grundstein für Regeln und Bedingungen des gesellschaftlichen und ökonomischen Handelns ( Abb. 9 ). Meine zentrale These lautet daher: Wenn der Handlungsdruck so groß ist, wie es die wissenschaftlichen Erkenntnisse nahelegen, dann muss es ein klares Primat für die Ökologie geben, das durch die Politik verbindlich umgesetzt wird und dem sich Gesellschaft und Wirtschaft unterzuordnen haben. Gleichwohl sind Gesellschaft und Wirtschaft aufgefordert, gemeinsam mit der Politik in demokratisch transparenten Prozessen, diese Vorgaben zu definieren. Die Umsetzung einer starken Nachhaltigkeit bedarf mithin eines transdisziplinären Ansatzes, in dem Natur- sowie Sozial-, Kultur- und Wirtschaftswissenschaften Abb. 8: Das gegenwärtige Modell der Nachhaltigkeit Abb. 9: Das anzustrebende Modell der Nachhaltigkeit gemeinsam mit Politik, Zivilgesellschaft und Unternehmen nach neuen Lösungen suchen, das natürliche Kapital nur in den erneuerbaren Mengen zu nutzen. Neuere ökonomische Ansätze wie z. B. die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber oder die Doughnut Economics von Kate Raworth streben bereits danach, in den planetaren Grenzen und unter Beachtung des sozialen Ausgleichs, ökonomisches Handeln radikal zu transformieren.
).
Читать дальше