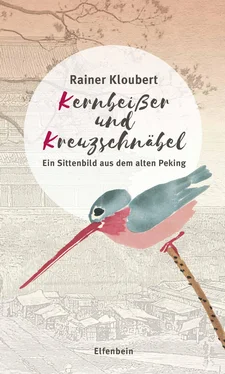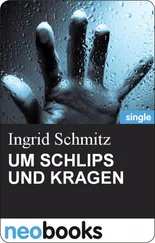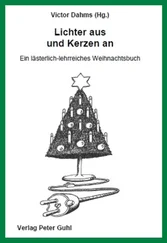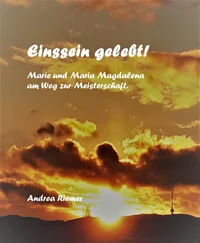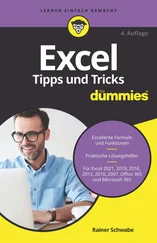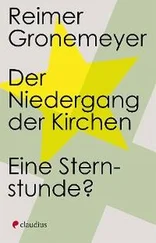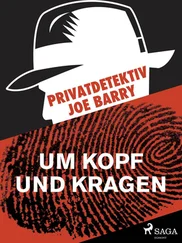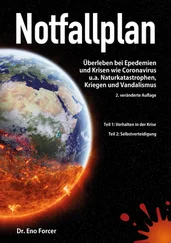»Le’ein le’eise«, sagte er leise auf Deutsch, »Lolelei«, und überreichte es mir. (Woher wusste er, dass ich aus Deutschland kam? Ein Wahrsager, sagte ich mir, natürlich wusste er es! Wer, wenn nicht er?) Er stand auf und setzte sich wieder zu seinen beiden Frauen. Die rechte zog einen Rosenkranz aus der Tasche und ließ die schwarzen Perlen – Oooooomitooooofooo – wie die Reihen der »ooooo« durch die rotlackierten Finger gleiten. Der Wahrsager nickte mir freundlich zu.
»She eve’y day«, rief er, zeigte auf die rechte Schwester und faltete die Hände zusammen. »P’lay Omitofo.«
Das Telephon klingelte, er hinkte zur Theke und hob den Hörer an sein Ohr.
»Lu?«, fragte er und schaute in die Runde. War das nicht mein chinesischer Name? Unsere Blicke trafen sich.
»Lebt nicht mehr«, sagte er.
Also so sah der Tod aus, dachte ich, als er auflegte und wieder auf mich zukam.
War ich gestorben?
Er schüttelte den Kopf, und wir kamen ins Gespräch.
Wahrsager Wang (王算命) war der Spross einer alten Pekinger Apotheker-Familie, die am »Gemüsemarkt« (菜市场) ein großes Geschäft besessen hatte: das »Kranichjahr« (鹤年堂), so sein Name. Vor dem Krieg war er einige Jahre in Europa gewesen, hatte dort Englisch und Deutsch gelernt und sprach ein wunderschönes Peking-Chinesisch, wie es nur waschechte Pekinger von sich geben: rollende und gleichzeitig nasale Lautfolgen, eingebettet in einer Tonlage, die sich wie das Schnurren eines gestreichelten Katers anhörte. Hans Albers, wenn er Chinesisch gesprochen hätte.
Er suchte eine Beschäftigung, ich einen Sprachlehrer. Wir vereinbarten ein Honorar und trafen uns von da an jeden Nachmittag für eine Stunde in einem Hinterzimmer des Astoria, wo er Klienten empfing und mit der Niederschrift einer Wahrsagelehre beschäftigt war: ein Almanach von tausend illustrierten Schlüsselszenen – Fahrt mit dem Motorrad, Hausbau, Reissaat etc. –, die über Begriffe und Zahlen miteinander kombiniert werden konnten und so Aussagen über zukünftige Ereignisse ermöglichten.
Also ein Wahrsager und Apotheker, verwandte Berufe. Ich vertraute ihm das Rätsel meiner Anfälle an. »Dämonische Besessenheiten« (鬼魅邪狂), diagnostizierte er, zu den Symptomen gehörten Selbstvergessenheit (不识自), Gehwut (狂走) und Halluzinationen (幻觉). Ich nickte: ja, Halluzinationen, Trugbilder. Guter Rat sei jetzt teuer, sagte er und runzelte die Stirn. In Peking hätte er mir »Dämonen-Austreibe-Pillen« (杀鬼丸) verschrieben, fuhr er fort, die Ingredienzen wären hier jedoch nicht zu bekommen, vor allem »Gu« (蠱) nicht, ein Insekt, das sich selbst erzeugt: man füllt ein Gefäß mit allem möglichen Kleingetier, verschließt es und öffnet es nach einem Jahr: »Gu« sei das Insekt, das nach Einverleibung aller anderen als einziges noch am Leben sei.
Die Ursache der Anfälle? Möglicherweise ein Fuchsgeist (狐精), sagte er. Sei ich in Taiwan einer Frau begegnet, zu der ich mich rätselhaft hingezogen gefühlt hätte – »gar schöne Spiele spiel ich mit dir«?
Ich überlegte. Ja, dachte ich, Spiele, eine Tante meiner chinesischen Frau, hatte mir welche beigebracht: Gevatterin Yin (尹妈妈).
Auch sie war vom Festland nach Taiwan geflohen, von Kalgan (张家口), der Grenzstadt zur Mongolei, wo sie erst Mama-san eines Bordells gewesen war, dann Konkubine eines Warlords, der nach ein paar Monaten das Zeitliche gesegnet hatte. Seitdem galt sie als »Füchsin« (狐狸请), aus chinesischer Sicht keineswegs eine böse Hexe, sondern auf ihre Weise eine ebenso geachtete Standesperson wie früher eine Klosterfrau in Europa. In Taiwan lebte sie zusammen mit einem ehemaligen Zuhälter, der sich mit ihrer Hilfe einen Namen als Wunderheiler gemacht hatte. Auch er war vor der Machtergreifung der Kommunisten in Kalgan ansässig gewesen, als Chauffeur des verblichenen Warlords. Ich dachte: Hatten beide ihn umgebracht?
Sie war eine Meisterin im Fadenspiel (翻绳儿): Durch gegenseitiges Abnehmen einer zwischen den Fingern gespannten Schlinge werden immer neue Figuren gebildet. Auch »Greifen« (挝子儿) hatte sie mir beigebracht, gelangweilte Konkubinen vertrieben sich in Kalgan damit die Zeit. Gespielt wurde es mit Stoffbällchen. Man platziert eine ungerade Anzahl (gewöhnlich fünf) von ihnen auf einen Tisch, den man vorher mit einer weichen Unterlage bedeckt hat. Die Regeln: Der Spieler Nr. 1 ergreift mit der rechten Hand das erste Bällchen, wirft es in die Höhe, fängt es mit der linken Hand auf, während er zur gleichen Zeit mit der rechten Hand ein zweites Bällchen ergreift und hochwirft, es mit der linken auffängt und so weiter, bis alle fünf Bällchen geworfen und wieder aufgefangen sind. Wer nicht alle wieder auffängt, scheidet aus. Bei den folgenden »Runden« (单元) wirft man gleichzeitig erst zwei, drei, dann vier usw. Bällchen in die Höhe und fängt sie wieder auf. Im letzten Durchgang wirft man alle fünf Bällchen auf einmal.
Wir spielten es, ich weiß nicht, wie viele Male. Ich schied schon bei drei Bällchen aus. Sie schaffte immer noch fünf. Ihre Augen waren dabei geschlossen, der Mund leicht geöffnet, ganz links blinkte ein Goldzahn auf; die Grübchen in ihren Wangen waren tiefer geworden. Ein Orgasmus?
Ich wäre gerne ein Kunde von ihr in dem Kalganer Bordell gewesen.
Wang brachte mir den Peking-Dialekt bei; die Zeichen lernte ich mithilfe eines ornithologischen Wörterbuchs und Swinhoes »Chinese Birds«, beide Bücher hatte ich in einem Rucksack stets bei mir. Im »Swinhoe« hatte ich auf der ersten Seite, für den Fall, dass ich wieder mein Gedächtnis verlieren sollte, meinen Namen und meine Adresse geschrieben. Aber würden sie mir etwas sagen?
Einmal saß ich mit meinen Büchern im Astoria Café auf meinem Lieblingsplatz am Fenster mit Blick auf den Tempel des Stadtgottes und einer daneben liegenden Autoreparaturwerkstätte: beides nach chinesischer Vorstellung Instandsetzungs- und Ausbesserungsbetriebe. Am Eingang des Tempels befand sich der Stand eines Wahrsagers, ein Kollege meines Sprachlehrers: ein älterer Herr in einem chinesischen Gewand, mit einem Jadeamulett an einem dünnen Goldkettchen um den Hals und einer blauen runden Sonnenbrille auf der Nase, der stolze Besitzer einer auf dem Rücken grasgrün gefiederten Kohlmeise – Parus cinereus var. monticolus insperatus (绿背山雀), so Swinhoe in seinem Katalog, »Rückchen« (子子背儿) war die landläufige Bezeichnung. Die Vögel gaben nur zwei Laute von sich: »hihi« (唏唏) und »haha« (哈哈), man verlor daher bald die Lust, ihnen zuzuhören. In Taiwan galten sie als bösartige »Vogelkobolde« (鸟精): Unglücksvögel, die mit bösen Mächten in Verbindung standen und dumme Zufälle und Pannen zu gefahrvollen Verwicklungen verknüpften.
Der Vogel zog gerade auf einen Wink des Wahrsagers aus einem Kasten einen dünnen rosa Zettel mit einem Horoskop hervor und überbrachte ihn seinem Herrn. Praktische Anweisungen standen darauf: heute besser nicht mit dem Motorrad fahren, einen Hausbau beginnen, Reisschößlinge setzen etc. Der Klient, ebenfalls mit einer Brille auf der Nase, saß auf einem Schemel neben dem Stand, während der Wahrsager, die Weissagungen auf dem Zettel erläuterte und mit seinem Pinsel ergänzte, derweil der drollige kleine Vogel, nachdem er ein paar Körner zur Belohnung bekommen hatte, trällernd und flötend – hihi (唏唏) – Kreise um den Stand und die benachbarte Autoreparaturwerkstätte flog. Vom Torraum des Tempels aus hatten zwei überlebensgroße und mit Lanzen, Schwertern und Knüppeln bewaffnete Torgötter ein wachsames Auge auf Wahrsager und Klient – der mit grimmig zusammengebissenen Zähnen hieß »Heng« (哼), der mit weit aufgerissenem Mund »Ha« (哈). Auf einem hohen und langen Tisch lagen die Opfergaben, die der Klient des Wahrsagers, um den Stadtgott gnädig zu stimmen, eben dort noch deponiert hatte: eine Pyramide polierter Äpfel, eine Flasche Sorghumschnaps und ein »Kentucky Fried Chicken«. Geister darf man nicht hungern lassen, sonst werden sie ungemütlich.
Читать дальше