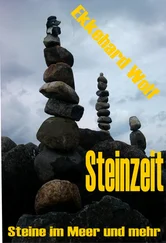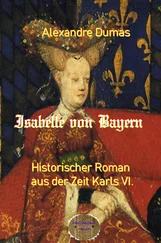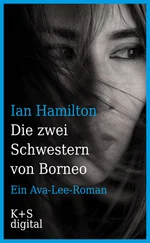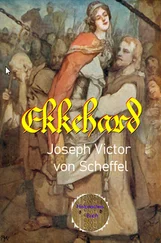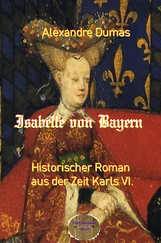Warum fällt es vielen Erwachsenen so schwer, den Begriff »Würde des Kindes« überhaupt zu denken? Ganz einfach: Die Leute verwechseln die Menschenwürde mit der Würde von Würdenträgern (»Ehrendoktorwürde«, »Hochwürden«, Funktionäre »in Amt und Würden«, vielleicht dereinst »in Würde ergraut«, »würdevoll gestorben« und »würdig bestattet«). Mit dieser Würde werden bestimmte Leistungen gewürdigt; etwa beim Storch genügt schon sein stolzes (»gravitätisches«) Stolzieren. Ein herumhampelndes Storchenkind würde niemals diesen würdigen Eindruck machen. Und nun erst die Menschenkinder! Plärren die nicht bei jeder Gelegenheit los, als wollte man sie vierteilen?
Um es kurz zu machen: Die Menschenwürde kommt jedem Menschen zu, unabhängig von jeglicher Leistung, gleichgültig, in wie »unwürdigen« Verhältnissen der Mensch leben mag oder wie »würdelos« er sich benimmt. Sie ist als unverlierbar gedacht und in den meisten Verfassungen als »unantastbar« festgeschrieben, damit sie wirklich keinem Menschen abgesprochen werden kann, auch nicht den Allerschwächsten, Allerärmsten und – nach Leistungsgesichtspunkten – Allerunwürdigsten. (Wäre das anders, hätten ja »entwürdigte« Menschen ihre Würde verloren und dürften dann behandelt werden, wie sie – als Menschen – eben nicht behandelt werden dürfen.) Genaugenommen kann es demnach gar keine im Sinne der Menschenwürde »entwürdigenden Erziehungsmaßnahmen« geben. Deshalb eignete sich dieser Gesetzestext (§ 1631 BGB: »Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen sind unzulässig«) so gut als politischer Kompromiß. Der Satz klingt kinderfreundlich, besagt aber rein gar nichts. Der Gesetzgeber kann allerdings behaupten und sich einbilden, er hätte Kinder als Menschen anerkannt und versucht, sie vor den bösen Eltern zu schützen.
Für das Prinzip der Gleichberechtigung aller Menschen ist es wichtig, die doppelte Bedeutung des Wortes »Würde« zu durchschauen. Denn daß die Menschen auf der Leistungsebene ungleich sind, ist offensichtlich. Auf der Ebene der Menschenwürde aber sind alle Menschen gleich.
Ebenso ist es mit den Menschenrechten. Sie kommen ohne Unterschied allen Menschen zu und sind nicht, wie die meisten anderen Rechte, mit Pflichten verkoppelt. Vielmehr sind es »Schutzrechte« (im Unterschied zu »Ordnungsrechten«), die der Mensch in der Demokratie einfach hat, weil er Mensch ist, gleichgültig was er kann, will, tut. Auf der Ebene der Menschenwürde sind alle Menschen einschließlich der Kinder gleichberechtigt.
Nun ist es einfach, solche Sätze niederzuschreiben. Daß Frauen und Männer gleichberechtigt sind, ist formal schon lange anerkannt; trotzdem werden Frauen in vielen Bereichen massiv benachteiligt. Was das Verhältnis zwischen den Geschlechtern verzerrt, ist die patriarchalische Tradition. Was das Verhältnis zwischen den Generationen verzerrt, ist die adultistische (erwachsenenzentrierte) Tradition. Der Weg zum Frieden ist noch weit. Die »Würde des Kindes« gedanklich sehr weit zu trennen von jeglicher Leistung oder gar »würdevollem« Benehmen, ist unseres Erachtens ein wichtiger, ein unverzichtbarer Schritt in die richtige Richtung. (Wenn Sie mögen, könnten Sie sich jetzt einmal gründlich durch den Kopf gehen lassen, was Ihre ganz persönliche Menschenwürde für Sie bedeutet. Vielleicht prüfen Sie auch, ob Sie das komische Wort »unantastbar« als notwendig und richtig nachempfinden können. Und falls nötig wäre es gut, wenn Sie sich mit dem Begriff »Würde des Kindes« möglichst phantasievoll vertraut machen könnten. Natürlich alles nur, wenn Sie nicht denken, das sei »unter Ihrer Würde«.)
»Zivilisation« ohne Gewalt?
Zu dieser kleinen, schlaglichtartigen Bestandsaufnahme gehören auch die jungen Menschen (sicher sind es mehrere zehntausend, vielleicht sogar einige hunderttausend in Deutschland), die im großen und ganzen in ihren Familien so leben, wie sie und wir es allen Menschen wünschen, eben gleichberechtigt – ob sie und ihre Eltern das so nannten oder nicht. (Wir meinen hier ausdrücklich nicht die »antiautoritär Erzogenen«, sofern beispielsweise deren Eltern ihre eigenen Menschenrechte denen der Kinder unterordnen zu müssen glauben.) Sind die Kinder aus gleichberechtigten Familien vielleicht wilde, barbarische Gestalten, rücksichtslos, disziplinlos, verantwortungslos, ohne Moral, hilflos ihren Trieben ausgeliefert, gemeingefährlich oder sonstwie »unzivilisiert«, weil ihre Eltern sie nicht »zügelten«, nicht zum »Hören« und sonst »Fühlen« zwangen, ihnen nichts von den Werten und Tugenden »einbleuten«, die immer herhalten müssen, wenn es gilt, Macht und Gewalt gegen Schwächere zu rechtfertigen?
Nach allem, was wir wissen, sind sie das nicht. Die jungen Menschen, die wir gut genug kennen und befragen konnten, unterscheiden sich in ihrem Verhalten (»Benehmen«) von anderen nicht so, daß ihnen auf den ersten Blick eine Besonderheit anzumerken wäre. Einige fühlen sich deutlich privilegiert, die anderen machen sich über solche Vergleiche keine Gedanken. Für uns ist nicht entscheidend, ob sie die »besseren Menschen« sind, sondern daß sie in besseren Beziehungen lebten und leben (was sie ausnahmslos bestätigten), daß zwischen Eltern und Kindern weitaus weniger »Streß« bestand und besteht (dito), daß alle Beteiligten deutlich zufriedener mit sich und ihren Kindern/Eltern waren und sind (dito). Daraus folgt, daß also die vielen Sorgen und Kämpfe, Skrupel und Enttäuschungen, besonders auch die vielen inneren Verwundungen und Verwüstungen, die Kinder erleiden, weil ihre Eltern oder andere »Erziehungsberechtigte« sich im Namen irgendwelcher »zivilisatorischen« Werte zur Machtausübung gegen ihre Kinder berechtigt oder verpflichtet fühlen, daß all dies mindestens unnötig ist.
Die im Abschnitt »Menschenverbesserer in Panik« zitierte Beobachtung, daß dem Menschen die Zivilisation »etwas Äußerliches geblieben sei«, nur »Fassade«, »Firnis« oder »Tünche«, sagt möglicherweise überhaupt nichts über die »Natur des Menschen« aus, sondern nur etwas über reale Menschen, denen von außen allerlei angeblich Schmückendes aufgeklatscht (um nicht zu sagen: geklapst) wurde. Wenn Menschen die Chance haben, sich von Anfang an als Subjekte, aktiv und frei, die Welt zu erobern, die sinnvollen Werte der Zivilisation zu entdecken, sie sich von innen heraus anzueignen (statt sich ihnen unterwerfen und anpassen zu müssen), wenn sie nicht mehr oder weniger gewaltsam zur Zivilisation gezogen werden, sondern in die Zivilisation hineinwachsen können – dann stellt sich womöglich heraus, daß weder der Mensch noch die Zivilisation das eigentliche Problem ist, sondern die Art und Weise, in der die beiden miteinander in Verbindung kommen oder gebracht werden. Vielleicht wollen ja die jüngsten Menschen gar nicht so schreckliche Gestalten sein oder werden, wie es die »Agenten der Zivilisation« gern behaupten, um ihre Unentbehrlichkeit zu unterstreichen? Vielleicht ist weniger – an Macht, Druck, Besserwisserei und so weiter – mehr? Und vielleicht ist sogar nichts – an Ungleichberechtigung – das allermeiste?
Am Ende dieses Kapitels, so glauben wir, besteht immerhin die Hoffnung, daß Kinder nicht unbedingt als zu zivilisierende Objekte angesehen werden müssen, die Schwerarbeit und vielerlei Kämpfe erfordern. Vielleicht genügt es einfach, sich Kindern gegenüber genauso zivilisiert zu benehmen wie gegenüber anderen Menschen, die man mag, auch.
Daß das nicht nur eine Hoffnung für Familien ist (oder gar »Kinderkram«), wollen wir im nächsten Kapitel in groben Zügen deutlich machen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Читать дальше