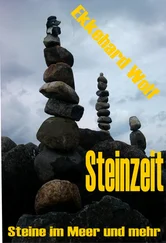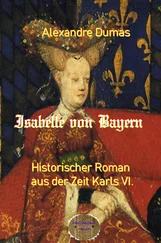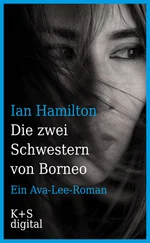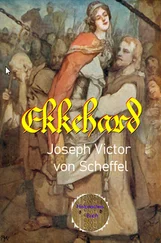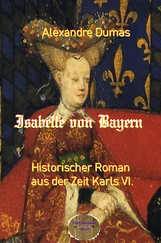In der Schule haben wir gelernt, daß die Neuzeit mit der »Aufklärung« begann, der Befreiung aus dumpfem Aberglauben, einem kühnen Aufbruch der menschlichen Emanzipation. Nun sehen wir, daß in Wahrheit »panisches Entsetzen« (Gronemeyer) die Triebfeder war, die nur zu neuem Aberglauben führte: dem Aberglauben, die Natur durch Wissenschaft und Technik unschädlich machen zu können; sie so perfekt zu unterwerfen, zu beherrschen, umzugestalten, daß der Mensch sich sicher fühlen kann. Die Natur wurde nur erforscht, um sich ihrer bemächtigen zu können; in grenzenloser Überheblichkeit wurden Pläne zur Welt- und Menschenverbesserung entwickelt und über Jahrhunderte Projekte vorangetrieben, die heute als Auswüchse des »Machbarkeitswahns« durchschaut sind. Dieser selbst aber wirkt noch fast ungebremst weiter, ebenso wie die von Gronemeyer aus der gleichen Quelle abgeleitete »Beschleunigung des Lebenstempos« im sinnlosen Kampf gegen die »Zeitknappheit«. (Das »neue Denken«, das heute vielfach gefordert wird, aber doch oft schnell wieder in die alten Bahnen des Mächens, der Selbstüberschätzung und der Gewalt einmündet, würde von Marianne Gronemeyers brillanten Analysen – besonders auch von dem Buch »Die Macht der Bedürfnisse« – mehr profitieren, als wir hier andeuten konnten.)
»Das Leben als dauernde Trotzphase«
könnte beinahe wie eine Fortsetzung von Gronemeyers »Das Leben als letzte Gelegenheit« wirken. Das Buch stellt den zivilisierten Menschen dar als Widerstandskämpfer gegen alles, was nur im entferntesten nach Vernunft riecht. Die Mentalität des wohlerzogenen Individuums ist geprägt vom Beharren auf einmal gefaßten Vorurteilen, einmal vertrauten Gebräuchen und einmal eingeübten Verhaltensweisen; unverblümt geht die Rede vom Menschen als Gewohnheitstier, ganz so, als sei seine herausragende Fähigkeit nicht die Freiheit des Geistes, sondern Rechthaberei und Unbelehrbarkeit. »Ich bin alt genug«, verkündet stolz der Fix- und Fertigerzogene, »ich bin doch kein Kind mehr«, und setzt offen seine Ehre darein, mehr Denkarbeit in die Vertuschung oder Rechtfertigung seiner Fehler zu investieren als in deren Korrektur. Schlägt das Schicksal zu und zwingt ihn zu neuen Einsichten, so tut er alles, um nichts tun zu müssen, keine Konsequenzen zu ziehen, keine neuen Entscheidungen zu treffen, nichts zu lernen.
Die Autoren untermauern ihre Befunde mit zahlreichen Beispielen, von den Liebenden, die aneinander herummeckern, über die Lehrenden, die die Lernfreude zerstören, bis hin zu den Politikern, die ausgerechnet unter den machtgierigsten Egozentrikern erwählt wurden, um dem Gemeinwohl zu dienen, obwohl jedem klar ist, daß sie die Bürger nur ausplündern und an der Nase herumführen können. Aber die Einzelheiten des sprichwörtlichen »alltäglichen Wahnsinns« möchten wir unseren Leserinnen und Lesern ersparen. Jedenfalls zeigt der erste Teil des Buches »Das Leben als dauernde Trotzphase« eindrucksvoll, wie leicht es möglich ist, die moderne Welt als Tollhaus zu beschreiben, in dem fast immer genau das Unvernünftigste geschieht und das Gegenteil des (angeblich) Beabsichtigten erreicht wird.
Im zweiten Teil wird dann geschildert, wie die Menschen von frühester Kindheit an auf dieses Leben vorbereitet, ja »hingetrimmt« werden. Und hier finden sich zahlreiche Beobachtungen, die auch für unser Buch von Bedeutung sind. Allgemein gesagt wird den Kindern die Vernunft systematisch unsympathisch gemacht, indem die Erwachsenen ihnen das Vernünftige mehr oder weniger gewaltsam aufzwingen. In den Gehirnen der Kinder verkoppelt sich zwangsläufig das Vernünftigsein mit dem Gehorsam. Die Kinder wurden »zur Vernunft (französisch: raison) gebracht«, das heißt zur Unterordnung, zum Nachgeben. Dies verletzt natürlich ihren Stolz, ihren Ehrgeiz, ihren Freiheitsdrang, ihre Selbstachtung, ihr Gerechtigkeitsempfinden und beeinträchtigt ihr Gemeinschaftsgefühl, ihr soziales Gewissen, ihre Verantwortungsfähigkeit. Sie speichern unendlich viele Ohnmachts-, Unlust-, Verzichtserfahrungen, und wenn sie dann »groß« sind, streben sie nach Macht, Lust und Konsum ohne Rücksicht auf die Folgen. Ihren Verstand benutzen sie nur noch zur Selbsttäuschung und zur möglichst raffinierten Täuschung und Manipulation anderer.
Angeblich, so die Autoren, erreichen doch noch einige Exemplare ein Ende der Trotzphase, nämlich die »Altersweisheit«. Doch die bleibt kraft- und folgenlos. (Leider gibt es das Buch »Das Leben als dauernde Trotzphase« noch nicht. Wir wollten Ihnen damit Gelegenheit geben, Ihre gesunde Trotzfähigkeit gegen uns zu testen.)
Sprachgebräuche und Redensarten
Beim Militär ist das Prinzip Befehl und Gehorsam normal und sinnvoll. Das Militär ist hierarchisch, von »oben« nach »unten«, organisiert. Ganz oben werden Informationen verarbeitet und Beschlüsse gefaßt, ganz unten wird nur gehorcht. Damit »Schütze Arsch« auch wirklich tut, was ihm gesagt wird, drohen ihm schwere Strafen, falls er es nicht tut. »Die da unten« müssen vor »denen da oben« genügend Angst haben, damit das Militär funktioniert, damit die Menschen zum Krieg fähig werden, damit sie nicht denken, sondern töten und sterben.
In vordemokratischen Zeiten war die zivile Gesellschaft ähnlich organisiert, ebenso wie viele Institutionen, etwa Kirchen, Wirtschaftsbetriebe und auch: Familien. Der Vater war das Oberhaupt, die Mutter hatte ihm zu gehorchen und den Kindern zu befehlen, die Kinder waren »brav«, »artig«, »folgsam«, oder sie wurden bestraft, verstoßen, getötet. Als Belohnung für ihren Gehorsam stand den Kindern vor Augen, daß sie als Erwachsene später selbst zu den Befehlshabern gehören würden. (Internationale Militärweisheit: »Wer befehlen will, muß gehorchen können.«)
Mit der Einführung der Demokratie verschwanden nicht alle hierarchische Strukturen aus der Gesellschaft, auch nicht aus der Familie und der Sprache.
»Darf ich’s wagen, Sie zu fragen …?« »Darf ich bitten?« »Gestatten Sie?« »Darf ich noch ein Brötchen haben?« »Ich weiß nicht, was ich machen soll.« »Was erlaubt der sich?« Manche solcher Redensarten sind nur als Höflichkeit gemeint, aber unbestreitbar fragen Kinder oft, ob sie etwas »dürfen«, »sollen«, oder sogar »müssen«, und auch in heutigen Familien gibt es noch Eltern, die sich von vordemokratischen »Experten« einreden ließen, es sei richtig, Kindern etwas zu befehlen, zu erlauben, zu verbieten und sie bei Ungehorsam zu bestrafen, ansonsten zu loben oder zu belohnen. Das Kind wird kaum anders behandelt als ein Haustier. Kein Gedanke an Gleichberechtigung. Wie Kinder von Eltern, in Kindergärten und Schulen noch oft herumkommandiert werden, spricht für sich. Das gleiche gilt für eine große Zahl von Sprachgewohnheiten, die Kinder verächtlich machen, ihnen ihren Platz ganz unten zuweisen. (Wir bringen hier keine Beispiele, damit wir Ihnen nicht die Idee nahelegen, wir wollten Sie beschämen, falls Sie selbst … Das Problem liegt gerade darin, daß solche Sprachgebräuche ganz unschuldig beibehalten werden, aber dennoch Wirkungen zeitigen. – Vielleicht achten Sie einmal im Alltag darauf, wieviel Respektlosigkeit, Oben-Unten-Denken und damit Unfrieden in Sprachgewohnheiten auch von »Zivilisierten« und »Zivilisten« stecken kann.)
Die Würde des Kindes ist …
Sie ist sehr leicht »antastbar«, wie jeder weiß, obwohl doch eigentlich --- Sind Kinder nicht auch Menschen? Und hat die Würde des Menschen – ihre Unantastbarkeit! – nicht höchsten Rang in der Verfassung?
In Deutschland sagt das Gesetz seit 1980, daß »entwürdigende Erziehungsmaßnahmen« unzulässig sind. Aber wenn dann jemand, der »erziehungsberechtigt« ist, ein Kind demütigt, beleidigt, einsperrt, verprügelt oder sonstwie – unterhalb der Grenze zur Krankenhausreife – schikaniert, erklären die höchsten Juristen, daß dies die Würde des Kindes nicht verletze, weil es ja seiner Erziehung dienen soll.
Читать дальше