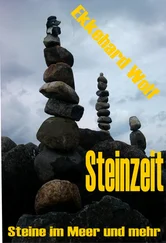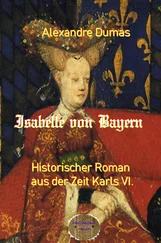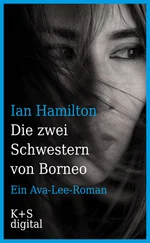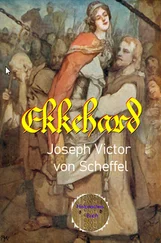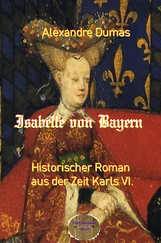Wir müssen nun der Versuchung widerstehen, diese hundertprozentige Bestätigung in irgendeiner Form als »Beweis« für dieses oder jenes »verkaufen« zu wollen. Wir sind zwar bei dem vorliegenden Buch in der Lage, von Tatsachen und Erfahrungen berichten zu können und (unseres Wissens: erstmalig in diesem Zusammenhang) nicht darauf angewiesen, auf der Ebene von bloßen An- und Absichten sowie mehr oder weniger plausiblen Wahrscheinlichkeiten zu operieren. Wenn wir oben »eindeutige und sichere Orientierungen« versprachen, mit deren Hilfe es »im Grunde leicht« sei, »den Überblick zu behalten und in jeder Situation das jeweils Bestmögliche zu tun«, so war dies also dadurch möglich, daß wir wirklich wissen, wovon wir sprechen.
Aber wir wissen ebenfalls, daß schon oft bestimmte Erfolge auf bestimmte Strategien zurückgeführt wurden und sich schließlich herausstellte, daß die beobachtete Wirkung keineswegs zwingend die Folge der behaupteten Ursache war. So könnte es sein, daß die Wirkung nicht wegen, sondern trotz der angeblichen Ursache zustandekam. Menschen besitzen außerdem in hohem Maße die Fähigkeit, nachträglich aus einer Not eine Tugend zu machen, analytisches Denken mit Wunschdenken zu verwechseln und über den erfreulichen Wirkungen bestimmter Ursachen ihre möglicherweise ganz anders gearteten Nebenwirkungen außer acht zu lassen.
Wir können es unseren Leser(inne)n – und uns -–also leider nicht so leicht machen, daß wir nur die Erfahrungen und Ansichten der jungen Leute wiedergeben, gewissermaßen als leuchtendes Vorbild zur punktgenauen Nachahmung. Unter anderem hat sich nämlich herausgestellt, daß gleichberechtigt aufgewachsene Menschen von sich aus dazu neigen, einige Probleme zu leicht zu nehmen (oder ganz zu übersehen), die Menschen mit völlig anderen Erfahrungen tatsächlich haben. Es gab schon immer Berichte über glückliche und geglückte Kindheiten, aber noch nie Einigkeit über die Schlußfolgerungen, die aus diesen oder jenen Einzelschicksalen gezogen werden können. Auf der Suche nach allgemeingültigen Prinzipien müssen wir über die Betrachtung von Einzelfällen hinaus im Positiven wie im Negativen die Gemeinsamkeiten herausarbeiten und dabei zunächst einmal alle noch so unterschiedlichen Meinungen in ihrer subjektiven Berechtigung ernstnehmen, verstehen und verständlich machen. Damit das möglich ist, werden wir unser Thema in verschiedenen Ansätzen behandeln, die vielerlei Erfahrungshintergründe, theoretische Positionen und nicht zuletzt aktuelle Diskussionszusammenhänge berücksichtigen. Allerdings möchten wir hier schon anmerken, daß nicht alle »aktuellen« Diskussionen in Wirklichkeit noch aktuell – im Sinne von: zeitgemäß – sind. Besonders im politischen Raum werden noch immer Meinungen vertreten und Behauptungen aufgestellt, die eindeutig bewiesenen Tatsachen widersprechen. Auch im »wissenschaftlichen« Raum werden noch Theorien verkündet, die für sich genommen weder beweisbar noch widerlegbar sind, aber offensichtlich nicht zu heute allgemein anerkannten Prinzipien und Werten passen. Welchen Sinn soll es haben, wenn immer wieder »alte Weisheiten« zitiert werden, um diese oder jene Ansicht zu unterstützen, wo deren Urheber doch in Zeiten lebten, die beispielsweise von Demokratie und Menschenrechten, wie wir sie heute verstehen (und die wir sicher nicht aufgeben wollen), gänzlich unbeleckt waren, in denen es keine Atomenergie gab, keine weltweite Überbevölkerung, keine Massenmedien, Computer, Umweltgifte, Müllhalden, Sorgentelefone, Arbeitsämter, Antibabypillen und so weiter, in denen die Erfahrungen von Weltkriegen, Atomwaffeneinsatz, Faschismus, Schulpflicht, AIDS und so weiter noch fehlten, in denen die Lebenserwartung Jahrzehnte geringer war, den Sterbenden die Seele aus dem Munde entwich, der Krieg als »Vater aller Dinge« gelten konnte, niemand vom »lebenslangen Lernen« sprach, ein »Ehrenwort« noch etwas galt und nicht in jeder zweiten Straße ein »Therapeut« praktizierte?
Diese Aufzählung ist ziemlich zufällig, kann aber beleuchten, wie fragwürdig viele Aussagen über »den Menschen« sind. Annahmen über »die Natur des Menschen« werden häufig allgemeingültig formuliert, beruhen jedoch auf höchst zeitgebundenen Voraussetzungen und Bedingungen. Wir können in diesem Buch schon aus Platzgründen nicht alle unsinnigen oder unpassend gewordenen Theorien der Vergangenheit, die heute noch eine Rolle spielen, widerlegen, sondern setzen darauf, daß die meisten sich von selbst erledigen, wenn wir an einigen Beispielen demonstriert haben, wie nützlich der Verzicht auf alte Denkschablonen für eine zugleich zeitgemäße wie zukunftsweisende Neuorientierung sein kann.
Schwieriger als der Umgang mit heute irreführenden Aussagen aus der Vergangenheit ist für uns das Problem zu bewältigen, das die Sprache selbst darstellt. Dabei meinen wir nicht das Problem, daß es zu vielen Begriffen unterschiedliche »Definitionen« gibt, die schon allein für zahlreiche Mißverständnisse (also geistiges »Durcheinander«) sorgen. Wörter transportieren nicht nur Botschaften von Verstand zu Verstand, die durch strenge Definitionen eindeutig, also allgemeinverständlich, »objektiv« gemacht werden können. Und Wörter transportieren auch nicht nur Gefühle, die schon im Prinzip subjektiv und kaum annäherungsweise »objektivierbar« sind. Unser Hauptproblem ist noch nicht einmal, daß viele Wörter selbst emotionale Anteile enthalten, die von Subjekt zu Subjekt unterschiedliche, ja gegensätzliche Wirkungen auslösen können. (Nicht einmal Begriffe wie »Kind«, »Mutter«, »Vater«, »Harmonie«, »Familie«, »Verwandtschaft« sind von allen Menschen gleichermaßen seelisch positiv »besetzt«.) Unsere sprachliche Hauptschwierigkeit liegt darin begründet, daß viele – und gerade viele der für unser Thema wichtigsten – Wörter Phänomene bezeichnen, die aus einem rationalen und einem emotionalen Anteil zusammengesetzt sind. Das von uns zugrundegelegte »Seele/Verstand-Modell«, das wir im Kapitel »Der Verstand denkt, und die Seele lenkt« darstellen, ist ein relativ neues Modell der Funktionsweise des menschlichen Zentralnervensystems (Gehirns), das naturgemäß noch keinen Einfluß auf die Entwicklung der Sprache nehmen konnte. Um nicht eine diesem Modell angepaßte Kunstsprache erfinden zu müssen, sind wir deshalb gezwungen, zu allerlei Notbehelfen zu greifen. Beispielsweise werden wir öfters »Seele« und »Verstand« fast wie eigenständige Organe oder sogar Personen mit bestimmten Eigenschaften, Fähigkeiten, Bestrebungen, Aufgaben behandeln, obwohl klar ist, daß jedes Individuum als unteilbarer Organismus und ganzheitlich funktionierendes System angesehen werden muß.
Sicher ließen sich die genannten Probleme auch anders bewältigen; aber wir haben uns von der Zielvorstellung leiten lassen, den »Weg zum Frieden« möglichst einfach verständlich und direkt nutzbringend zu beschreiben (anstatt beispielsweise auf akademische Gepflogenheiten Rücksicht zu nehmen oder auf tages- und parteipolitische Konsequenzen zu spekulieren). Genau genommen beschreiben wir nicht einen bestimmten Weg, der Schritt für Schritt gegangen werden sollte – wir können und wollen niemandem etwas »vorschreiben« oder gar »Vorschriften machen« –, sondern wir wollen einige traditionelle, aber heute durchschaubare Irrwege, Fallen, Abgründe, Stolpersteine, Hürden, Sackgassen … oder einfach Denkfehler kenntlich machen, deren Vermeidung den Blick freigibt zugleich auf Ziel und Weg und zugleich für »Kopf« und »Herz« und »Bauch«. Die Bestätigung, daß die Gleichberechtigung im Kinderzimmer funktioniert, ist für uns eine Selbstverständlichkeit, sagt aber noch nichts darüber, warum und wie sie funktioniert. »Selbstverständlich« ist die hundertprozentige Zustimmung der »Kinder« einfach deshalb, weil sie nicht mehr oder weniger passiv, als Objekte oder gar Opfer bestimmten elterlichen Verhaltensweisen ausgesetzt waren, sondern aktiv, als Subjekte und vielfach auch Ideengeber das Familienleben mitgestalteten, und zwar gleichberechtigt, also optimal. Auch in anderen Familien sind Kinder nicht passive Objekte, sondern aktive Mitgestalter; aber häufig bleibt ihnen keine andere Wahl, als um ihre Rechte, ihre Freiheit, ihre Selbstachtung gegen die Eltern zu kämpfen. Sie gestalten also nicht gute »Liebes«-Beziehungen gleichberechtigt mit, sondern finden sich in Machtbeziehungen verstrickt, in denen (mindestens) die Gesetze der Konkurrenz gelten, nicht die der Kooperation. Obwohl wir mit vielen Weisen der Meinung sind, daß es besser ist, eine Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen, werden wir nicht ganz auf eine – allerdings kurze und bruchstückhafte – »Bestandsaufnahme« (nächstes Kapitel) und die darauf folgende Einordnung unseres Themas in »größere« Zusammenhänge verzichten. Um in dem zitierten Bild der »Weisen« zu bleiben: Unsere eigenen Kerzen brennen schließlich munter genug vor sich hin. In unserem Buch aber müssen wir erst einmal zeigen, warum es sich lohnen soll, daß auch andere Menschen sich um Kerzen und Streichhölzer bemühen, und dabei nicht riskieren, daß alles in Feuer und Flammen aufgeht, sondern erreichen, daß ihr Leben nur einfach wärmer und heller wird.
Читать дальше