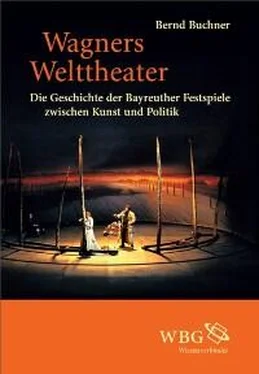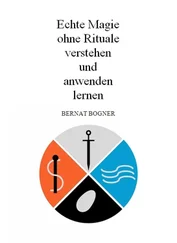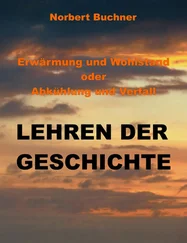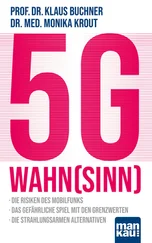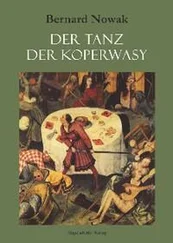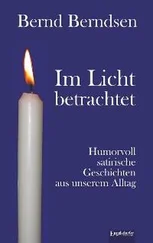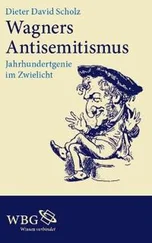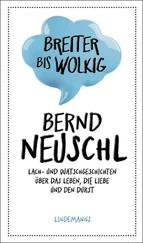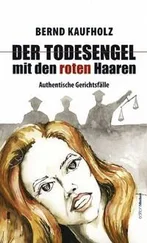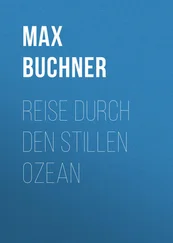1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 Bemerkenswerterweise behielt Wagner seinen Einfluss auf Ludwig II. auch nach dem erneuten Gang in die Schweiz aufrecht. Im Jahr 1866 spielte dies insbesondere im preußisch-österreichischen Konflikt eine Rolle. Wagners Verhältnis zu Preußen, dessen Truppen 1849 den Dresdner Aufstand niedergeschlagen hatten, war zwiegespalten. Der Komponist wandte sich entschieden gegen eine von Bismarck anvisierte kleindeutsche Lösung und warb für einen Nationalstaat unter Einschluss Österreichs.58 In diesem Sinne versuchte er auch, den bayerischen König zu beeinflussen. Wagner begeisterte sich für das 1865 erschienene Buch Die Wiederherstellung Deutschlands von Constantin Frantz (1817–1891) und empfahl es Ludwig II. zur Lektüre.59 Gegen die preußische Machtpolitik plädierte Frantz darin für ein dreigeteiltes, förderalistisches Deutschland. Auch für Wagner stand Preußen im Gegensatz zum deutschen Volksgeist.60 An den bayerischen Monarchen schrieb er noch am 29. April 1866 über Bismarck und König Wilhelm: „Mit welcher grauenhaften Frivolität hier mit den Schicksalen der edelsten, größten Nation der Erde gespielt wird: wie dort ein ehrgeiziger Junker seinen schwachsinnigen König auf das frechste betrügt und ihn ein unehrenwertes Spiel spielen lässt, vor dem, wenn er es erkännte, der rechtschaffende Monarch sich entsetzen würde“.61 Anfang Juni 1866 indes, kurz vor dem preußisch-österreichischen Waffengang, hat sich Wagners Ton deutlich gemildert, er verzichtet auf harsche Töne gegenüber dem künftigen Sieger. In seinem „politischen Programm“ für Ludwig II. deutete sich die veränderte Großwetterlage unüberhörbar an.62 Der Komponist hält Preußen und Österreich gleichermaßen vor, bundesbrüchig geworden zu sein. Von Bayern erwartete er hingegen die Suche nach einem politischen Ausweg. Wagner plädierte für einen erneuerten, militärisch aufgerüsteten Deutschen Bund als Gegengewicht gegen die beiden Mächte.
Am 20. Juni 1866 beginnt der deutsch-deutsche Krieg, Bayern zieht an der Seite Österreichs in die Schlacht gegen Preußen. Drei Tage später schreibt Wagner an seinen alten Barrikadennachbarn Röckel: „Freund! Willst und musst Du noch Politik treiben, so – halte Dich an Bismarck u. Preußen. Hilf Gott, ich weiß nichts andres.“ Doch glaubt Wagner noch an die Macht der Geschichte: „Deutschland kann kein zentralisierter Staat werden: grade die Preußen werden es erfahren, dass nur Föderalismus in Deutschland möglich ist.“63 Als Wagner dies schreibt, hatte Bismarck bereits versucht, ihn als Mittelsmann für die preußische Sache zu gewinnen.64 Schon zuvor gab es Versuche, Wagner für höhere politische Zwecke zu benutzen: Fürst Maximilian Karl von Thurn und Taxis wollte ein Königreich Rheinland-Westfalen mit seinem Sohn als Regenten schaffen. Wagner sollte den bayerischen König in diesem Sinne beeinflussen, lehnt das aber ab.65 Nun war der Komponist dazu ausersehen, Bayern auf die Seite Preußens zu ziehen. Mittelsmann war François Wille, ein Studienfreund Bismarcks. Doch Wagner behauptete, keinerlei politischen Einfluss auf Ludwig II. zu haben. Wenn er die Sprache auf Politik bringe, schaue der König immer in die Luft und pfeife.66
Der gescheiterte Einflussversuch hatte immerhin eine Langzeitwirkung. Wagner setzte sich noch während des Krieges, der am 3. Juli in der Schlacht bei Königgrätz entschieden wurde, dafür ein, dass der preußenfreundliche Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst bayerischer Ministerpräsident wird.67 Im Dezember 1866 folgte der König dem Rat.68 Am 24. Juli 1866 schrieb Wagner an Ludwig II.: „Während Deutschland politisch sich vielleicht in einen langen Winterschlaf unter preußischer Obhut begibt, bereiten Wir wohl und ruhig und still den edlen Herd, an welchem sich einst die deutsche Sonne wieder entzünden soll.“69 Bei anderer Gelegenheit riet er seinem königlichen Mäzen zu einer Aufrüstung gegen Frankreich, da ein „Kampf zwischen französischer Zivilisation und deutschem Geiste“ im Gange sei.70 Österreich war für Wagner als Machtfaktor offenbar vollkommen abgeschrieben. Nach Königgrätz ließ er mit Hans und Cosima von Bülow Bismarck hochleben, das borussisch euphorisierte Trio erkor „delenda Austria“ (Zerstört Österreich) zum Wahlspruch.71 Den deutsch-französischen Krieg von 1870 begrüßte der Komponist uneingeschränkt.72 Dieser sei „nur gemacht, um mir zu meinem Ziele zu verhelfen“.73 Gemeint war die Gründung der Festspiele und die Aufführung des Nibelungendramas. Wagner wollte Bismarck persönlich bitten, Paris zu vernichten.74 Nach dem deutschen Sieg gegen Frankreich verspottete Wagner die Unterlegenen nicht nur in dem erwähnten Gedicht An das deutsche Heer vor Paris . Das Bombardement auf die Stadt bereitete den Wagners wiederholt Genugtuung.75 Und die Anrufung des deutschen Gewissens durch Victor Hugo im November 1870 beantwortete der Komponist in einem reichlich geschmacklosen „Lustspiel in antiker Manier“, betitelt Eine Kapitulation , in dem er das hungernde Paris verhöhnte.76
Idee und Wirklichkeit. Auf dem Weg zum Grünen Hügel
In Paris hatte Wagner einst selbst gehungert. Er lebte von 1839 bis 1842 in der Stadt an der Seine und machte als brotloser Künstler schlimme Zeiten durch. Dennoch kehrte er später immer wieder in die französische Weltstadt zurück, und selbst seine Festspielidee ist mit ihr verbunden. Anfang der 1860er Jahre wollte der Komponist in Paris, durch den dortigen Misserfolg mit dem Tannhäuser nur unzureichend entmutigt, im Théâtre Italien eine „deutsche Musteroper“ ins Leben rufen.77 Im Zusammenhang mit den dann gescheiterten Plänen entstand erstmals der Gedanke, Festspiele in den sommerlichen Theaterferien durchzuführen – eine für das spätere Bayreuth grundlegende Idee. Carl Dahlhaus mutmaßt sogar, die von Wagner so sehr verachtete Grand opéra, die im 19. Jahrhundert den musikalischen Weltruf von Paris ausmachte, könnte das „heimliche Vorbild der Bayreuther Gründung“ gewesen sein.78 Beide Formen des dramatischen Musikfestes hätten sich als Abbild und Ausdruck der Gesellschaft verstanden, die Pariser Oper der bürgerlichen, das Wagnerfest der utopisch-nachrevolutionären. Darin liegt aber bereits ein wesentlicher Unterschied, der auf den entschieden politischen Charakter der Absichten Richard Wagners ebenso verweist wie auf die unabdingbaren künstlerischen Voraussetzungen und die „Distanz zum Alltag“ (Udo Bermbach)79 als herausragendes Element des Festspielgedankens.
Worin besteht dieser Gedanke? Dass „Bayreuth“ Wirklichkeit geworden ist und die Nachwelt noch immer Wagners Welttheater bestaunen kann, legt den Schluss nahe, das Unternehmen fuße auf einem stringenten Plan des Komponisten. Das aber ist ein Irrtum.80 „ Die Festspielidee Richard Wagners gibt es nicht“, stellt Dahlhaus fest.81 Auch von bloßen Abwandlungen eines durchgängigen Prinzips könne schwerlich die Rede sein. Mehr als die Hälfte der betreffenden, für die deutsche Geschichte prägenden Zeit zwischen der gescheiterten Revolution von 1848 und der kleindeutschen Reichsgründung verbrachte der Komponist im Exil. So verwundert es kaum, dass der Festspielgedanke kein geschlossenes musikalisch-ideologisches Gerüst ist, sondern zahllosen Wandlungen, Modifizierungen, Verzerrungen, Umkehrungen unterworfen war. Forscher finden oft nur Assoziationen an entlegenen Stellen oder briefliche Nebenbemerkungen, „dann wieder geschlossene Konzepte“.82 Immerhin lassen sich einige Faktoren benennen, die im Lauf der Zeit stärker oder schwächer wurden, sich verdichteten oder an Bedeutung verloren. Es sind Programm, Ort, Publikum, Organisation und Finanzierung. Dreh- und Angelpunkt ist ein monumentales Werk, die Tetralogie Der Ring des Nibelungen – verbunden mit der Frage, wo und unter welchen Umständen es sich aufführen lässt. Wagner will einen abgelegenen Ort, weit entfernt von herkömmlichen Opernhäusern, damit sich das Publikum mit ganzer Aufmerksamkeit seinem neuartigen Musikdrama widmen kann. Ob der Komponist ein einmaliges Fest oder ein wiederkehrendes Ereignis anstrebt, lässt er zunächst offen, entscheidet sich später aber für eine dauerhafte Einrichtung mit dem dafür notwendigen organisatorischen Apparat. Die Finanzfrage war von vornherein das größte Problem des Unternehmens.
Читать дальше