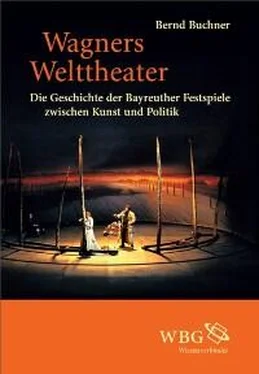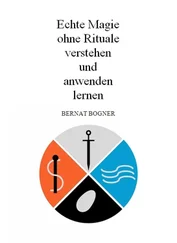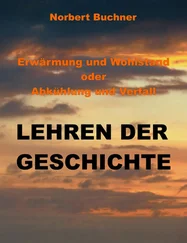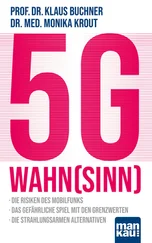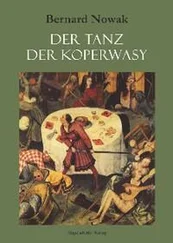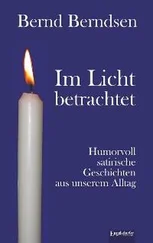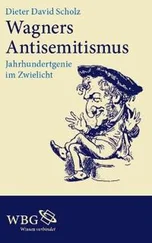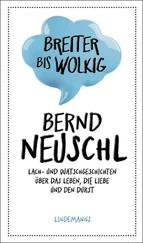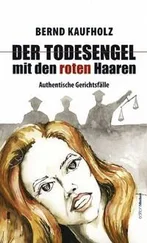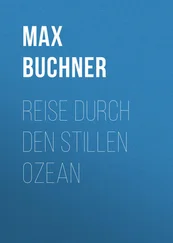Solcherlei Treffen zwischen politischen Potentaten und Künstlern hatte es in der deutschen Geschichte schon mehrmals gegeben. Bach traf Friedrich den Großen, als dieser noch nicht groß genannt wurde, Mozart war bei Joseph II., Beethoven begegnete den Fürsten des Wiener Kongresses. Den Hintergrund bildete dabei stets das musikalische Interesse der Politiker.12 Das war bei Bismarck und Wagner anders – und das wirkte nach. Der Reichskanzler verkörperte für Wagner dauerhaft die „Missachtung seines Werkes“ durch das Reich.13 Was blieb, waren Ironie und Invektiven. Wagner war für Bismarck schlicht ein „Affe“, der Komponist wiederum titulierte den Fürsten als „Sauhetzer“ und „Bulldogg-Gesicht“.14 Bei allen Beschimpfungen hat sich Wagner auch immer wieder respektvoll, ja freundlich über ihn geäußert – kaum aber einmal, ohne zugleich seine eigene Bedeutung hervorzukehren: „Ich bin mit Bismarck der einzige Deutsche, der was wert ist“, sagte er.15 Die beiden großen Gestalten des 19. Jahrhunderts hatten persönlich wenig Gemeinsamkeiten, versuchten aber, sich gegenseitig zu benutzen: Wagner wollte von Bismarck politische Unterstützung für seine Kunst, Bismarck wiederum spannte den Künstler Wagner für seine politischen Zwecke ein. Selten genug, dass der Reichskanzler echtes Interesse an Kultur aufbrachte. Doch auch dann, wenn er es tat, waren seine Motive politischer Natur. Als ihn Wilhelm II. einige Jahre nach Wagners Tod fragte, wie er sich zu den Bayreuther Festspielen stellen solle, lehnte Bismarck eine zu große Nähe des Reichs als politisch gefährlich ab.16 So konnte Harry Graf Kessler zu Recht konstatieren: „Wirklich hatten Wagner und Bismarck in den Mitteln, mit denen sie wirkten, und auch in der Taktik, durch die sie siegten, manches gemein.“17
In Bayreuth wirkten Wagners Aversionen nur kurz nach. Als beide Persönlichkeiten tot und die Festspiele finanziell gesichert waren, der Eiserne Kanzler sich in einen Mythos verwandelt hatte, wurde er eingemeindet. Im Programmheft von 1924 tönte ein Autor: „Wagners und Bismarcks Geist; nur sie zusammen schaffen uns Deutschen Heil!“18 Auch die Familie des Komponisten war nicht nachtragend. Siegfrieds Schwester Eva Chamberlain berichtete im Februar 1919, mitten in der Revolutionszeit, stolz von einer mächtigen Bismarck-Büste von Reinhold Begas, die sie geschenkt bekommen habe: „Als kräftigende Mahnung u. ermutigende Hoffnung steht nun dieser große Deutsche am Eingang in unser Haus. Mein Mann fand, dass wir ihrer täglichen Gegenwart bedurften. Vielleicht verscheucht er uns die Herrn Spartakuse, die ja nun auch hier ihr Unwesen trieben.“19
Der politische Wagner: Ein Rückblick
An Richard Wagner selbst hätten die „Spartakuse“ womöglich ihre Freude gehabt, wenngleich keine ungeteilte. Nach dem Scheitern der Revolution von 1848/49, an der er in Dresden führend teilgenommen hatte, propagierte der Komponist die „Erlösung in den Kommunismus “20 – auch wenn er den Begriff als Gegenbild zum gesellschaftlichen Egoismus verstand und die marxistische „Lehre der mathematisch gleichen Verteilung des Gutes und Erwerbes“ als sinn- und gedankenlos ablehnte.21 Ob Wagner nun Revolutionär oder Reformer, Sozialist oder Protofaschist war, ist noch immer höchst umstritten. Seine politische Haltung, sein politisches Wirken, seine Wandlungen und nicht zuletzt auch die politischen Aspekte in seinem Werk waren jedenfalls grundlegend für die Entwicklung der Bayreuther Festspiele. Wagner wuchs in eine Zeit hinein, die von Restauration und Biedermeier geprägt war und in der zugleich die beginnende Industrialisierung zu massiven wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen führte. Für den Heranwachsenden markiert die Pariser Julirevolution von 1830 einen entscheidenden Politisierungsschub: „[M]it einem Schlag wurde ich Revolutionär und gelangte zu der Überzeugung, jeder halbwegs strebsame Mensch dürfe sich ausschließlich nur mit Politik beschäftigen“.22 Die Verbindung von Kunst und Politik lag damals in der Luft. Beethoven hatte seine Eroica Napoleon zum Geschenk gemacht, zog aber die Widmung zurück, nachdem sich der Franzose zum Kaiser erhob. Er vertonte zudem Schillers Ode an die Freude – und die intendierte politische Freiheit zog die künstlerische Freiheit nach sich, das Wort von der Musik zu emanzipieren, wie es der Komponist in seiner 9. Symphonie mit der Verwendung mehrerer Strophen als Chorgesang im letzten Satz dann tat. Für Wagners Kunst sollte dies zu einem Glaubenssatz werden. Während sein philosophischer Lehrmeister Schopenhauer, übrigens ein ausgewiesener Verächter der Tonkunst, ganz im Sinne der politisch-antipolitischen Romantik die Ansicht vertrat, der Musiker spreche die höchste Weisheit in einer Sprache aus, die seine Vernunft nicht verstehe, musste die Musik nach dem Verständnis von Wagner dramatisch und mit dem Wort verbunden sein, denn im Gegensatz zum Dichter könne der Musiker „nur Stimmungen, Gefühle, Leidenschaften und deren Gegensätze, nicht aber irgendwie politische Verhältnisse ausdrücken“.23
Erhebliches Gespür für die Bewegungen seiner Zeit wird schon beim 21-jährigen Wagner deutlich, der sich wortstark über die „altdeutsch schwarzgerockten Demagogen“ und die „deutschtümelnden Musikkenner“ zu mokieren weiß – schon auf der ersten Seite des frühesten Prosatextes findet sich eine Parallelisierung von politischen und künstlerischen Gesichtspunkten.24 Jener Text, betitelt Die deutsche Oper , erschien 1834. Im gleichen Jahr wurde Heinrich Laube (1806–1884) wegen seiner Begeisterung für die Julirevolution aus Sachsen ausgewiesen. Der Wortführer des Jungen Deutschlands übte bedeutenden Einfluss auf Wagner aus.25 Viele seiner Positionen haben ihren Ursprung im Denken dieser literarisch-politischen Bewegung des Vormärz, etwa die Ablehnung der alten ständischen wie auch der sich herausbildenden bürgerlichen Ordnung, die scharfe Kritik am „Übermut einer Kultur, welche den menschlichen Geist nur als Dampfkraft der Maschine verwendet“26 und ein regelrechter „Ekel vor der modernen Welt“27. Laube gehörte zu den Linkshegelianern, und Wagner folgte ihm darin. Bis ans Ende seines Lebens, stellt Udo Bermbach fest, habe der Komponist nicht verleugnet, woher sein gesellschaftstheoretisches Denken stammte, „so wenig wie die Tatsache, dass seine Vorstellungen von Politik und politischer Organisation sich dem radikaldemokratischen Diskurs des deutschen Vormärz verdankten“.28 Das Spannungsverhältnis zwischen einem als unpolitisch verstandenen Patriotismus und scharfer Gesellschaftskritik bildet sich bei Wagner in seinen Pariser Jahren 1839 bis 1842 sowie in der folgenden Zeit als Hofkapellmeister in Dresden heraus. In Paris wurde er mit dem Gedankengut der französischen Frühsozialisten vertraut, vor allem Saint-Simon, Proudhon und Fourier. Sein deutscher Patriotismus wiederum sei entstanden, „als die Pariser Weltluft mich mit immer eisigerer Kälte anwehte“.29 Die Fremdheit in der französischen Metropole verstärkte ein Heimatgefühl, dessen politische Bedeutung in der Hinwendung zur Vergangenheit lag. Die deutsche Begeisterung für das Mittelalter, so Herfried Münkler, sei im 19. Jahrhundert als Antwort auf den französischen Revolutionsmythos entstanden: Das Mittelalter sei dabei zugleich romantisiert wie germanisiert worden, um den Mythos nicht mit dem ungeliebten Nachbarn teilen zu müssen.30
Die vermeintliche Weltflucht verband sich im Denken Wagners mit einem Frontalangriff auf die Gesellschaftsstrukturen seiner Zeit. Seine Welt, schrieb er, werde „eben genau da erst eintreten, wo die gegenwärtige aufhörte; oder da, wo Politiker und Sozialisten zu Ende wären, würden wir anfangen“.31 Auch in Wagners Operntexten aus jener Zeit spiegeln sich seine „utopischen Visionen zum Verhältnis von Politik, Gesellschaft und Kunst“ (Udo Bermbach)32. In den politischen Schriften ging er mit dem Postulat der sozialen Gleichheit deutlich über die Saint-Simonisten und Fourieristen hinaus.33 Wagners Ausgangspunkt ist dabei stets die Kunst, der er die entscheidende gesellschaftliche Hebelwirkung zuschreibt. In Oper und Drama setzt er die Verfallsgeschichte von Oper und Gesellschaft kurzerhand gleich.34 Und in der Mitteilung an meine Freunde heißt es: „Auf dem Wege des Nachsinnens über die Möglichkeit einer gründlichen Änderung unserer Theaterverhältnisse, ward ich ganz von selbst auf die volle Erkenntnis der Nichtswürdigkeit der politischen und sozialen Zustände hingetrieben, die aus sich gerade keine anderen öffentlichen Kunstzustände bedingen konnten, als eben die von mir angegriffenen .“35 Die Veränderung der Gesellschaft scheint für ihn umgekehrt nur insofern von Belang zu sein, als er sich davon die Reform der Kultur versprach. Mit dieser radikalen Präferenz nahm Wagner im Spektrum der freiheitlichen deutschen Nationalbewegung des 19. Jahrhunderts eine besondere Rolle ein. Er habe zwar an die „Notwendigkeit und Unaufhaltsamkeit“ der Revolution geglaubt, wird er später festhalten. Doch habe es ihm ferngelegen, „das Neue zu bezeichnen, was auf den Trümmern einer lügenhaften Welt als neue politische Ordnung erwachsen sollte“. Begeistert habe er sich vielmehr gefühlt, „das Kunstwerk zu zeichnen, welches auf den Trümmern einer lügenhaften Kunst erstehen sollte“.36
Читать дальше