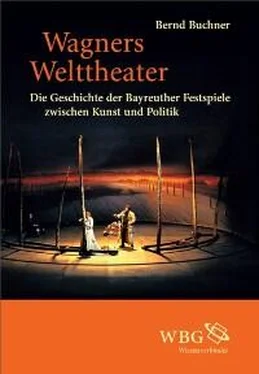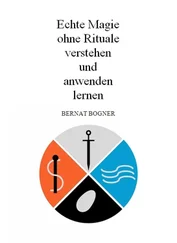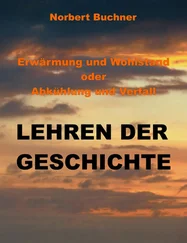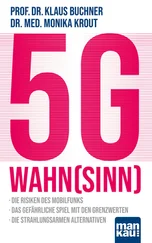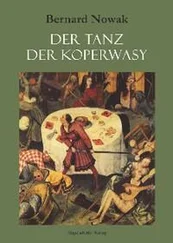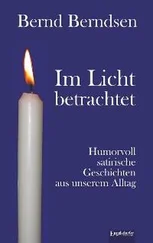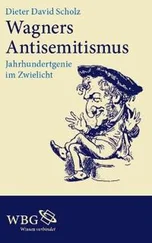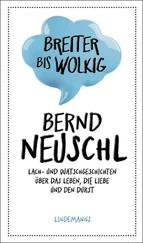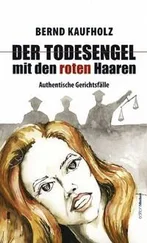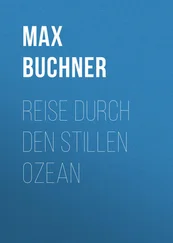1 ...8 9 10 12 13 14 ...19 1854 kündigte Wagner an, binnen zwei Jahren mit der Ring -Komposition fertig sein zu wollen, um sich dann an das „Unmögliche“ zu machen: „mir mein eigenes Theater zu schaffen, mit dem ich vor ganz Europa mein Werk als grosses dramatisches Musikfest aufführe. Dann gebe Gott, dass ich meinen letzten Seufzer von mir stoße!“100 Mit der Komposition gerät Wagner allerdings bald darauf in eine Sackgasse, so dass er die musikalische Arbeit am Ring – den Text hatte er bereits 1853 abgeschlossen – 1857 für mehr als ein Jahrzehnt unterbrach. Andere Projekte, vor allem die Oper Tristan und Isolde , durch die Wagner die Liebesaffäre mit Mathilde Wesendonck künstlerisch aufarbeitete, hatten Vorrang. Unter veränderten Voraussetzungen nahm Wagner den Festspielgedanken einige Zeit später wieder auf. In einem Brief an Hans von Bülow brachte er Ende 1861 Paris, Wien und Berlin als mögliche Festspielorte ins Gespräch. Dabei dachte er allerdings offenbar nicht an den Ring . „Da ich nicht mehr Franzose werden kann, bleiben mir nur die beiden deutschen Hauptstädte. Obwohl Wien sehr musikalisch ist, halte ich doch Berlin, auch wie du es neulich mir schilderst, für wichtiger und förderlicher.“101 Wien wurde dem Komponisten zudem durch das Tristan -Fiasko verleidet: Fast drei Jahre lang wurde die Oper dort geprobt und schließlich für unaufführbar befunden. Wagners Anforderungen an das Orchester und die Titelpartien seien zu hoch, hieß es. Das bestärkte ihn im Wunsch nach einem eigenen Festspieltheater, in den Folgejahren nahmen die Pläne wieder bestimmtere Formen an.
In einem Vorwort zur Ring -Dichtung, die 1862 im Druck erschien, stellte Wagner noch einmal die Leitlinien dar. Zwar äußert er sich am Ende skeptisch über die Erfolgsaussichten: „Ich hoffe nicht mehr, die Aufführung meines Bühnenfestspieles zu erleben: darf ich ja kaum hoffen, noch Muße und Lust zur Vollendung der musikalischen Komposition zu finden.“102 Doch ein entschlossener Grundton ist unüberhörbar. Wagner stellt sich die Aufführung seines Bühnenfestspiels als „frei von den Einwirkungen des Repertoireganges unserer stehenden Theater“ vor. „Demnach hatte ich eine der minder großen Städte Deutschlands, günstig gelegen, und zur Aufnahme außerordentlicher Gäste geeignet, anzunehmen, namentlich eine solche, in welcher mit einem größeren stehenden Theater nicht zu kollidieren, somit auch einem großstädtischen eigentlichen Theaterpublikum und seinen Gewohnheiten nicht gegenüberzutreten wäre.“103 In jener Kleinstadt „sollte nun ein provisorisches Theater, so einfach wie möglich, vielleicht bloß aus Holz, und nur auf künstlerische Zweckmäßigkeit des Inneren berechnet, aufgerichtet werden; einen Plan hierzu, mit amphitheatralischer Einrichtung für das Publikum, und dem großen Vorteile der Unsichtbarmachung des Orchesters, hatte ich mit einem erfahrenen, geistvollen Architekten in Besprechung gezogen.“ Vorgesehen sind drei vollständige Ring -Aufführungen. Nicht nur zu den organisatorischen Fragen des Theaterprojekts, auch zur Finanzierung macht der Künstler detaillierte Angaben. Einer mäzenatischen „Vereinigung kunstliebender vermögender Männer und Frauen“ zeigt er sich skeptisch gegenüber, vielmehr hofft er auf einen Fürsten, der die Mittel für seine Residenzoper auf das Wagnerprojekt umzulenken bereit wäre. „Wird dieser Fürst sich finden?“104
Der Fürst fand sich 1864 in Gestalt von König Ludwig II. von Bayern. Er war nicht nur für den Künstler Feuer und Flamme, sondern auch für dessen Festspielgedanken. Rasch entschloss sich Ludwig, für Wagner ein monumentales Festspieltheater in München bauen zu lassen.105 Gottfried Semper lieferte die Entwürfe. Der Bau, der auf der rechten Isarhöhe nahe des Maximilianeums und mit Sichtbeziehung zur Residenz entstehen sollte, ließ von Wagners ursprünglicher Idee nur wenig übrig. Gedacht war an ein Nationaltheater, kein Privattheater für seine Werke. Unverkennbar war die Tendenz zur Sakralisierung: Der König sprach von den „Geweihten“, die den „heiligen Bau“ einst beträten.106 Die Pläne scheiterten durch finanzielle Schwierigkeiten und politische Intrigen, auch die oberste Baubehörde legte ihr Veto ein.107 Selbst eine abgespeckte Version als Einbau in den Münchner Glaspalast erwies sich als utopisch. Ludwig II. gab das Vorhaben aber nie ganz auf. Noch im März 1868 sprach er davon, es sei nur aufgeschoben. Wenig später wollte er Wagner mit dem Bau von Schloss Neuschwanstein ehren, das „ein würdiger Tempel für den göttlichen Freund“ werden sollte.108 Mit Wagners Festspielidee hatte das nichts zu tun. Diese hatte im Lauf der Jahre zahllose Modifikationen durchlaufen, die sich in Gegensatzpaaren beschreiben lassen: Provinz versus Metropole, Einmaligkeit versus Wiederkehr, Nationalbühne versus Privattheater, fürstliche Finanzierung versus Mäzenatentum. Als Ort der Festspiele sah Wagner ursprünglich Zürich vor, wo er Anfang der 1850er Jahre wohnte. Er veranstaltete dort im Mai 1853 auch Festspiele, allerdings nicht auf einer Bretterbühne vor den Stadttoren, sondern im dortigen Theater.109 Der Rhein als Aufführungsort, wie ihn der Komponist 1851 genannt hatte, stellt eine inhaltliche Nähe zur Ring -Tetralogie her und erfüllt die Bedingung der Abgeschiedenheit – Cosima Wagner sollte diesen Gedanken später wieder aufgreifen. Weimar wiederum, das 1856 von Franz Liszt ins Gespräch gebracht wurde, wäre mit einem Wagner-Festspielhaus „zur zentralen nationalen Kult- und Weihestätte eines Doppelmythos von Klassik und Richard Wagners Musikdramen geworden“ (Peter Merseburger)110. Dies widerstrebte dem selbstbewussten Komponisten. Der Festspielcharakter und die verlangte „Distanz zum Alltag“ hätten sich in Zürich oder Weimar allerdings mit Sicherheit besser verwirklichen lassen als in Berlin, Wien oder München, die in den 1860er Jahren ins Gespräch kamen. Das Lob der Provinz, das später in Bayreuth anklang, war also eher der Macht des Faktischen geschuldet.
Auch das Dogma der Einmaligkeit gab Wagner rasch wieder auf. Es entsprach auch nicht dem Vorbild der griechischen Antike. Der Zwiespalt drücke bei Wagner keine Entwicklung des Festspielgedankens aus, so Carl Dahlhaus, sondern eine Unentschiedenheit.111 „Wagner, der ursprünglich von einem Gefühl für die Würde der Vergänglichkeit erfüllt war, ist schließlich dem Drang nach Monumentalisierung verfallen.“ Große Varianz legt Wagner bei der Frage an den Tag, ob er ein Nationaltheater oder ein privates Unternehmen gründen will. Immer wieder hatte er sich unter Berufung auf den „deutschen Geist“ für ein Nationaltheater starkgemacht, diesen Gedanken aber nicht mit den eigenen Plänen in Verbindung gebracht. Konstitutiv für die Festspielidee war ferner die Frage, welche Werke in einem von Wagner zu errichtenden Bühnenhaus auf dem Programm stehen sollen. Er hat ursprünglich an nichts anderes als an den Ring gedacht. Das war aber kein Dogma. In Zürich formulierte er den Gedanken, auch seine frühen Opern Tannhäuser, Holländer und Lohengrin aufzuführen.112 Die Pariser Pläne für eine „deutsche Musteroper“ Anfang der 1860er Jahre sahen Tristan und Isolde sowie Tannhäuser vor, nicht aber das Nibelungendrama.113 Im Ring -Vorwort von 1862 schließlich regt Wagner an, auch zeitgenössische Werke anderer Künstler ins Programm zu nehmen. Diese, so seine Bedingung, müssten allerdings stilistisch seinen eigenen Musikdramen gleichen.
Als weitsichtig erwies sich Wagner bei der Planung des Bühnenbaus – hier ist unter allen Faktoren der Festspielidee die größte Kontinuität sichtbar.114 Das Festspielhaus wurde ab 1872 letztlich genau so errichtet, wie der Komponist es von Anfang an wollte: mit unsichtbarem Orchester sowie einem amphitheatralischen, während der Aufführungen vollkommen verdunkelten Zuschauerraum. Mit seinem Fachwerk erinnert es von außen sogar an die einst imaginierte provisorische Bretterbude vor den Toren Zürichs. Was den Spielplan betraf, kehrte Wagner zu seinem Ausgangsgedanken zurück, im Festspielhaus ausschließlich den Ring zeigen zu wollen. Deshalb konnte es nicht verwundern, dass der Komponist die separaten, von Ludwig II. befohlenen Münchner Uraufführungen von Rheingold 1869 und Walküre 1870 als schwere Kränkung und Demütigung empfinden musste. Der König wiederum sah in Wagners Widerstand eine Majestätsbeleidigung. Er wies seinen Hofrat Düfflipp an, die „widerstrebenden Kräfte“ zum Gehorsam zurückzuführen und zu unterwerfen.115 Der zornige Regent fühlte sich im Recht – er war Eigentümer der Ring -Partitur, doch zugleich verstieß er gegen Wagners Festspielgedanken.116 Wagner war danach gleichsam als Ideologe seiner eigenen Idee gezwungen, seine Pläne zu konkretisieren und endlich nach einem passenden Ort zu suchen.117 Da Siegfried unmittelbar vor der musikalischen Vollendung stand, musste der Komponist zudem befürchten, dass sich sein königlicher Seelenfreund auch dieses Werks zwecks Münchner Aufführung bemächtigen würde. Ludwig II. erwog sogar, die beiden ersten Akte der Oper zu zeigen, da der dritte noch gar nicht komponiert war.118
Читать дальше