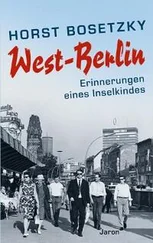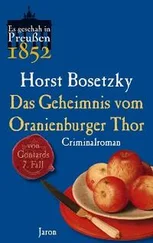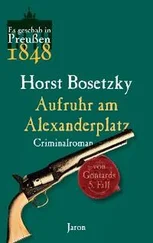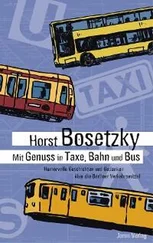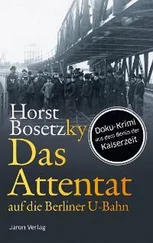Am Leopoldplatz hatte er von der U6 in die U9 umzusteigen. Eine Zeitung hatte am letzten Ersten gemeldet, die großen Clubs des American Football würden ihre Spieler zum Training auf die großen Berliner Umsteigebahnhöfe schicken, und dazu einen Star der Berlin Thunder abgebildet. Natürlich war das ein Aprilscherz gewesen, doch er hatte es für logisch gehalten und geglaubt. Auch heute wieder verspürte er eine gewisse Regung, seine Dienstwaffe zu ziehen und wenigstens in die Luft zu schießen, um den Zug auf dem unteren Bahnsteig zu erreichen. Ohne dieses Mittel hatte er keine Chance gegen die Lahmärsche, die ihm den Weg versperrten. Als er endlich unten angekommen war, hörte er nur noch das harsche «Zurückbleiben bitte!», und weg war sein Zug.
Sein Vater hatte bei solchen Anlässen immer gemurmelt: «Wieder habe ich einen fahren lassen.» Dass damit das Flatieren gemeint war, verstand heute kein Mensch mehr, ebenso wie sie ihn ahnungslos ansahen, wenn er den Kollegen erzählte, dass ihr neuer Vorgesetzter im Flur «einen Koffer« habe stehen lassen. Sein Großvater hatte immer eine diebische Freude daran gehabt, in der überfüllten U- oder S-Bahn «einen durch die Reihen schleichen« zu lassen.
Das war das Schöne an der U-Bahn, dass der nächste Zug schon nach fünf Minuten kam. Und er bekam sogar einen Sitzplatz. In seinem Alter hatte er auch einen Anspruch darauf.
Zoologischer Garten stieg Mannhardt aus und überlegte einen Augenblick, ob er in die U2 umsteigen und bis zum Wittenbergplatz fahren oder zu Fuß zu seiner Dienststelle in der Keithstraße laufen sollte. Schließlich entschied er sich für den Fußweg, denn es war immer ganz spannend, an der Rückseite des Zoologischen Gartens entlangzulaufen. Links hatte man die Kolonnaden mit ihren vielen Läden, das Aquarium und den Nebeneingang des Zoos, rechts den Breitscheidplatz mit der Gedächtniskirche und den Prachtbau der Grundkreditbank.
Ein Tourist aus St. Irgendwo sprach ihn an. Wo denn hier der Olof-Palme-Platz sei.
Mannhardt zuckte mit den Schultern. «Tut mir leid, nie gehört.»
Sekunden später sah er anhand der Schilder, dass er mitten auf dem Olof-Palme-Platz stand, einer Ausbuchtung der Budapester Straße an ihrer Kreuzung mit der Nürnberger und der Kurfürstenstraße. Peinlich. Besonders für einen Kriminalbeamten. Schnell machte er, dass er weiterkam.
Die Tage, die Mannhardt noch ins Büro ging, waren gezählt, und sein Nachfolger saß schon bei ihm im Zimmer, um eingearbeitet zu werden. Der Kollege hörte auf den Namen Rico Schönbier und war noch so jung, dass es eine einzige Provokation war. Mannhardt hatte ihn vom ersten Augenblick an nicht gemocht. Schönbier sah aus wie ein hoffnungsvoller Fußballer aus der Oberliga, die Haare teilweise blond gefärbt und mit viel Gel zu Stacheln aufgerichtet und geistig nur so weit entwickelt, dass es seine Instinkte beim Passen und Toreschießen nicht sonderlich störte. Das Fitnessstudio war sein zweites Zuhause. Dort holte er sich die Kondition, um durch die Clubs der Stadt zu ziehen und ständig neue Frauen zu beglücken. Hörte er das Wort Kultur, schrie er nur «Scheiße!» und machte sich aus dem Staub. Auch von Politik hielt er nichts und vermied es, sich die Namen der Akteure zu merken. «Wenn ich die bei mir im Gehirn speichere, tue ich diesen Hanseln doch zu viel Ehre an.» Aber auch um die Heroen des Showgeschäfts, der Medien und des Sports kümmerte er sich wenig. «Was interessieren mich diese Arschlöcher?!» Er, Rico Schönbier, war das Maß aller Dinge, und an ihm gemessen waren das alles nur Blender. «Von irgendwelchen Idioten hochgepusht, um Geld mit ihnen zu machen.»
Mannhardt hasste «geistige Tiefflieger« wie Schönbier und sagte des Öfteren zu Heike, dass Oswald Spengler bei dessen Anblick den Untergang des Abendlandes neu geschrieben hätte, doch gegen Schönbier war nicht anzukommen, denn alle seine Prüfungen hatte er mit Einsen und Zweien bestanden, und auch seine dienstlichen Beurteilungen ließen nichts zu wünschen übrig.
Mühsamer als sonst stieg Mannhardt die Treppen zu seinem Büro hinauf, sich dabei selber verspottend: Der alte Mann und das Gehtnichtmehr. Wie viele Morde mochte er in seinen mehr als vierzig Dienstjahren aufgeklärt haben? Schätzungsweise 250. Nicht er allein, die Mordkommissionen, in denen er gearbeitet hatte. Und der nächste würde vielleicht der letzte sein.
Yaiza Teetzmann lief vor ihm her, seine langjährige Kollegin und engste Vertraute. Stellte er sich die Frage, was er in seinem Leben am meisten bedauerte, dann war es die Tatsache, nie mit ihr geschlafen zu haben. Blieb ihm nur sein Fontane als Trost: Eigentlich ist es ein Glück, ein Leben lang an einer Sehnsucht zu lutschen.
Sie musste ihn hinter sich gespürt haben, denn sie blieb stehen und drehte sich um. «Danke für die Einladung zu deiner Abschiedsparty.»
«Bitte.» Mannhardt schnaufte ein wenig, als er sie eingeholt hatte. «Es wird ein Top-Event werden. Wie damals im alten Rom, als Petronius Abschied von allen und allem genommen hat.»
«Wer war Petronius?»
«Ein römischer Schriftsteller und Satiriker, ein Weltmann am Hofe Neros, der ‹Schiedsrichter des feinen Geschmacks›. Als Nero ihn bezichtigte, an einer Verschwörung gegen ihn teilgenommen zu haben, und ihm die Hinrichtung drohte, beging er vorher Selbstmord. Dazu lud er alle seine Freunde ein, schnitt sich in deren Gesellschaft die Pulsadern auf, tauchte die Arme in eine Schüssel mit warmem Wasser und dämmerte langsam dahin.»
Yaiza Teetzmann verstand die Zusammenhänge nicht ganz. «Hat dir denn der Polizeipräsident angedroht, dich verhaften und einsperren zu lassen?»
«Es geht darum, dass ich stilvoll von allem Abschied nehmen möchte.»
«Eine Pensionierung ist doch kein Todesurteil.»
«Für mich schon.»
Yaiza Teetzmann lachte. «Du kannst doch versuchen, wieder Lehrveranstaltungen an der Fachhochschule zu bekommen.»
«Ja, keine schlechte Idee: Opa erzählt euch mal, wie wir damals den Berliner S-Bahn-Mörder und die Bestie vom Schlesischen Bahnhof zur Strecke gebracht haben.»
«So alt bist du doch nun auch wieder nicht.» Mannhardt stöhnte auf. «Man ist immer so alt, wie man sich fühlt – und mein gefühltes Lebensalter liegt heute bei 110.»
«Genau das richtige für einen Polizeibeamten.» Mannhardt schwieg. Yaiza Teetzmann würde ihm fehlen. Nicht nur ihres Anblicks wegen.
Schönbier wartete schon in der Tür seines Büros. Mannhardt nannte das «Zimmerbesetzung», aber er hatte sie nicht verhindern können. Wie jedes Lebewesen reagierte er erbost darauf, ein anderes Männchen in seinem Revier zu sehen.
«Grüß Gott», murmelte Mannhardt, weil er wusste, dass sich Schönbier darüber ärgerte. «Was gibt es Neues?»
«Leichenfund in Schmöckwitz. Wir müssen raus.»
«Gut, fahren wir. Aber Yaiza soll mit.» Mannhardt grauste es davor, so lange mit Schönbier allein im Wagen zu sitzen.
Zu dritt machten sie sich auf den Weg in Berlins südöstlichsten Zipfel. Schon auf dem Parkplatz kam es zur ersten kollegialen Auseinandersetzung. Wer sollte am Steuer des geleasten Dienstwagens sitzen? Mannhardt wollte nicht. Als ehemaliger West-Berliner war er noch immer ein wenig traumatisiert, wenn es darum ging, im gewesenen Ost-Berlin am motorisierten Individualverkehr teilzunehmen. Nie vergaß er das barsche «Fahren Sie mal rechts ran!» und die Angst vor stundenlangen Verhören, an deren Ende Bautzen stehen konnte.
Yaiza Teetzmann als Mädchen aus Marzahn kannte diese Ängste nicht, hatte aber eine instinktive Abneigung gegen alle Westautos. Ihr Vater, SED-Funktionär und ein sogenannter Zweihundertprozentiger, hatte sie in diesem Sinne erzogen. BMW und Mercedes fuhren die Bonner Ultras, die Kapitalisten, die Ausbeuter, die Kriegstreiber.
Für Schönbier war ein Auto ein Auto und eine Straße in Köpenick (ehemals Ost-Berlin) nicht anders als eine in Neukölln (ehemals West-Berlin), und fahren sollte der, der das am besten konnte, also er. Generell hasste er es, wenn die Wessis wie auch die Ossis «diesen ganzen alten Scheiß« immer wieder aufwärmten. Seine Mutter war eine Russlanddeutsche, und von seinem Vater hieß es, er sei Deutschtürke gewesen, so genau wusste das keiner, denn der Gute hatte sich nach der Zeugung seines Sohnes schnell in die Emirate abgesetzt. «Wo ist da das Problem?», fragte Schönbier, wenn ihn jemand mitleidig ansah, und er hatte wirklich keines damit. Im Gegenteil. Bedingt durch die Gene seines Vaters, sah er immer so braungebrannt aus, dass er sich das Sonnenstudio und den Hautkrebs sparen konnte.
Читать дальше