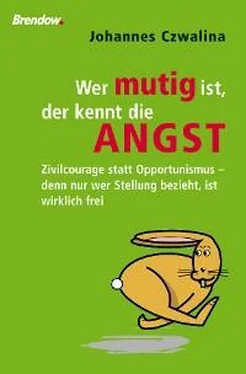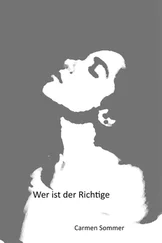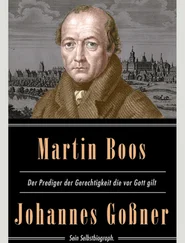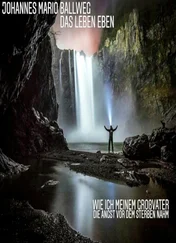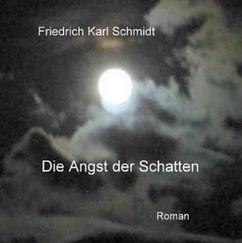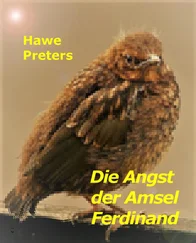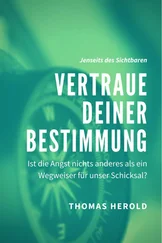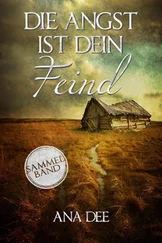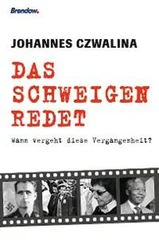Emmi Bonhoeffer reflektiert: »Es gibt in der ganzen Welt, glaube ich, keine Widerstandsbewegung, wenn es den Leuten von Tag zu Tag besser geht. Moralische Gründe und politische Weitsicht reichen nicht aus, wenn die Leute Butter auf dem Brot haben. Ich habe nach dem Krieg mal in Kärnten Urlaub gemacht und dort mit einem Bauern gesprochen. Ich fragte: ›Sie leben hier in einer fromm katholischen Gegend. Wie war das eigentlich während des Krieges? Hat der Priester Ihnen gesagt, wie wir uns in Russland benahmen, was da in Polen in den Konzentrationslagern passierte?‹ Der Bauer antwortete: ›Wir waren fünf Kinder, mein Vater arbeitslos, mein großer Bruder auch, meine Mutter arbeitete acht Stunden auf dem Nachbarhof für einen Liter Milch, und dann kam Hitler. Mein Vater kriegte Arbeit, mein Bruder auch, meine Mutter konnte zuhause bleiben, und Sie fragen, was der Priester sagte.‹ Brecht hatte es auf die kurze Formel gebracht: ›Erst kommt das Fressen, dann die Moral.‹ So ist der Mensch.«14
Es gab eine Menge guter Kollegen, denen ihre Karriere wichtiger war als persönliche Werte.
Die größten Enttäuschungen erlebte ich mit Menschen, die gekniffen haben, wenn es auf sie ankam. Es handelte sich um sogenannte Freunde, die plötzlich nicht mehr da waren, wenn rechterhalten der Freundschaft Nachteile brachte. Sie tauchten unerwartet unter, weil ihnen Machtpositionen und Anerkennung plötzlich mehr bedeuteten als die Verbindlichkeiten einer Freundschaft. Es gab eine persönliche Werte, von denen sie vorher ihr Persönlichkeitsprofil ableiteten. Natürlich hatten alle immer eine plausible Erklärung parat.
Wenn es sogar Nachteile für die eigene Karriere bringt, sich hinter den Freund zu stellen, hält im Business nur noch ein Prozent der Betroffenen zum Freund.
Von einem Unternehmensberater wurde mir Folgendes berichtet: Wenn ein Vorstand in seinem Unternehmen in Ungnade fällt, kann er sich kaum auf seine Freunde verlassen. Wenn es für die anderen Nachteile bringt, sich hinter seine Person zu stellen, bekunden am Anfang noch 80 Prozent seiner bisherigen Freunde die Solidarität, aber nur dann, wenn dies unter vier Augen geschieht. Sind die gleichen Leute in einer Gruppe mit anderen, bekennen sich nur noch 30 Prozent zu ihrem Freund. Geht es darum, unter Druck, ohne dass es eigene Vorteile bringt, zu dem Freund zu stehen, bleiben nur noch 3 Prozent übrig. Wenn es sogar Nachteile für die eigene Karriere bringt, sich hinter den Freund zu stellen, ist es nur noch 1 Prozent, das zu seinem Freund hält.
In dem Augenblick, in dem der Betreffende couragierte Freundschaft dringend benötigt, fallen die bisherigen Anhänger wie ein lautlos versinkendes Begleitschiff vom bisher Umschwärmten ab. Außer den Konformisten scheint plötzlich auch der Kreis derjenigen, die ihn so gut kennen, dass sie ein echtes Urteil über die Qualität des Diffamierten haben müssten, wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Tief schmerzlich werden dann die Verleumdungen derjenigen Menschen empfunden, die dem nun Entehrten ihr Leben und ihren Aufstieg verdanken. Das ist immer so. Derjenige, der ins Schussfeld einer Hetzjagd gerät, sollte nichts anderes erwarten. Der Angeklagte hatte ein Heer von Menschen gehabt, die ihm zujubelten. Angesichts der Vorwürfe steht er jedoch abrupt verlassen da; denn dem Ansehen der Karriere der einst Verbündeten wäre Freundestreue dieser Art abträglich. Der innerste Kreis hält auch nur, wenn er sehr stabil ist. Es zeigen sich Schadenfreude, Besserwisserei und kopfschüttelndes Missachten in unverblümt taktloser Form. Jeder weiß, wie er es anders und besser gemacht hätte.
Ich erinnere mich auch an meine Schulzeit in Berlin, als wir im Geschichtsunterricht das Dritte Reich durchnahmen. Uns wurde beigebracht, dass wir immer allem misstrauisch gegenübertreten sollen, was uns keine andere Wahl lässt. Wir wurden auf gewisse Sätze als Indikatoren für falsche Gedankensysteme hingewiesen. Wir fragten uns damals als Schüler, warum diese Lehrer, die ja in dieser Zeit, von der sie sprachen, schon mündige Erwachsene waren, nicht schon früher ihre Erkenntnisse umgesetzt hatten, als es noch nicht zu spät gewesen war, und warum sie nicht schon vorher ihre Erkenntnisse lebten, statt später uns zu belehren? Ich schreibe das ohne Groll, und ich frage mich selbst oft, was unsere Enkel einmal in der Schule über fehlende Zivilcourage lernen werden, wenn sie die gegenwärtige Zeitepoche in ihrem Geschichtsunterricht behandeln, und was wir ihnen antworten werden: »Wir hatten keine andere Wahl.«15 –»Der Markt hat uns bedingungslos gezwungen«?
Der Journalist Karl-Otto Saur, dessen Vater unter Hitler Verantwortlicher für die Ankurbelung der Kriegsrüstung und für den Nachschub für Zwangsarbeiter war, schreibt in seiner Biografie, dass er sich immer wieder fragt, wie er sich selbst wohl verhalten hätte damals in der Diktatur. Und er findet keine Antwort darauf. In den Redaktionen, in denen er gearbeitet hat, habe er sich ebenso oft gefragt, was aus seinen Kollegen damals wohl geworden wäre. Wer wäre ein Nazi gewesen? Wer ein Täter? Wer ein Mitläufer? Diesen Blick bringe er nicht mehr raus aus seinem Kopf. Vielleicht sei das auch der Grund, warum Erfolg und Karriere nie Begriffe waren, die er für wichtig hielt im Sinne eines geglückten Lebens. Er habe in seinem Leben nur ein Ziel gehabt: Er wollte es besser machen mit seinen Kindern, als es sein Vater gemacht habe.16
Einige der älteren Generation erinnern sich noch an ein Flugblatt der Harnack/Schulze-Boysen-Organisation, welches in Berlin im Winter 1941/42 verteilt wurde.17
»Stellt euch der allgemeinen Angst entgegen! Immer wieder hört man die Redewendung: ›Wir müssen durch! Wenn wir jetzt nicht siegen, geht es uns allen schrecklich an den Kragen. ‹Dies ist das Gerede, das die derzeitigen Machthaber selbst verbreiten, um ihre Herrschaft zu festigen. […] Die Weltgeschichte wird auf keinen Fall ihren tieferen Sinn verlieren, und das Unmögliche wird nicht möglich dadurch, dass wir uns in Verkennung der Dinge bemühen, dem Verbrechen und dem Wahnwitz zum Siege zu verhelfen, nur weil Verbrechen und Wahnwitz sich zur Zeit in Deutschland eingenistet haben.«
Auch heute haben viele resigniert. Sie ahnen zwar, dass Zivilcourage der unter Beweis gestellte Mut zur Suche nach einem sinnerfüllten Leben ist. Aber sie sind zu dem Ergebnis gekommen: Zivilcourage lohnt sich nicht. Sie sind müde geworden und haben den Mut verloren und finden sich mit einem Leben ab, das keine Sinnfragen mehr beantwortet. Sie suchen den Sinn nur noch im Trubel des Alltagsgeschäftes und im Streben nach persönlichem Wohlstand.
Bismarck gebrauchte als erster Deutscher das Wort Zivilcourage.18 In einer Debatte des Preußischen Landtags 1864 wurde er wegen eines kritischen Beitrages ausgepfiffen. Beim Mittagessen sagte ihm ein älterer Verwandter: »Eigentlich hattest du ja ganz recht. Nur sagt man so was nicht.« Da antwortete Bismarck: »Wenn du meiner Meinung warst, hättest du mir beistehen sollen.«
Meine Ausführungen wenden sich genau an diejenigen, die mutig sein wollen und denen diese Eigenschaft wichtiger ist als schnelle Karriere, bei der es auf Opportunismus und Ellenbogen ankommt. Meine Ausführungen wenden sich auch an Menschen, die mutig sein wollen, aber nicht die nötige Kraft dazu aufbringen .
»Willst du was werden, musst du schweigen.
Musst dich zur Erden tief verneigen.
Dass du ein Knecht bist, hat man gerne.
Allem, was recht ist, halte dich ferne.
Lerne den Willen unserer Lenker.
Und auch im Stillen sei kein Denker.«19
So beschrieb Hoffmann von Fallersleben diesen Irrtum schon vor 160 Jahren im Hundertjährigen Kalender – Bezug nehmend auf den deutschen Zeughaussturm am 14. Juni 1848.
Stefan Heim drückte es etwas unpoetischer aus in seiner Rede bei der Wende in Leipzig 1989: »Ein Volk, das gelernt hat, zu kuschen unter dem Kaiser, unter Hitler, unter dem DDR-Regime.«
Читать дальше