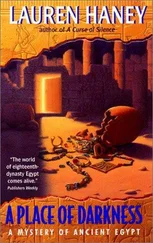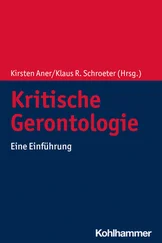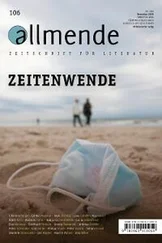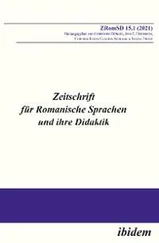1 ...6 7 8 10 11 12 ...15 Die Quintessenz von Adornos Kritik am Totalitätsdenken des Idealismus ist nicht dessen völlige Liquidation. Gemessen an den Vorgaben Kants und Hegels, die er für die Negative Dialektik reklamiert, ergibt sich eine argumentative Doppelstrategie: »Mit Kant gegen Kant, aber auch mit Hegel gegen Hegel, dies macht eines der Hauptmotive des Adornoschen Denkens aus«30. Substanziell bedeutet dies:
»Indem Adorno der Hegelschen Dialektik in ihrem wesentlichsten Punkt – der Geistkonzeption – nicht folgt, indem er aber gleichwohl an einem Verständnis von Dialektik festhält, demzufolge letztere nicht nur ein methodisches Instrument darstellt, sondern etwas mit der Sache selbst zu tun hat, ist er Nicht-Hegelianer und Hegelianer zugleich. Insofern Adorno andererseits Kant dahin gehend folgt, dass auch für ihn alles Erkennen vorgängig an Begriffe gebunden ist, über die das erkennende Subjekt nicht frei verfügt, die ihm vielmehr erst einmal vorgegeben sind, weshalb das ›Ding an sich‹ in der Tat (erst einmal) nicht zu erfassen ist, ist er Kantianer. Zugleich aber ist er auch Nicht-Kantianer, denn: Die alle Erkenntnis vorgängig bestimmenden Begriffe versteht Adorno nicht als Begriffe, die dem Subjekt transzendental und damit nicht hintergehbar vorgegeben sind, sondern er versteht sie als historisch entwickelte und deshalb als sehr wohl hintergehbare«31.
Die Auseinandersetzung mit Kant und Hegel ist für die Negative Dialektik elementar, denn Kants numinos bleibendes ›Ding an sich‹ konstituiert sich erst durch die subjektiven Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung, mithin durch subjektive Begriffsbildungskompetenz. Damit wird aber erschlichen, dass alles Seiende unter eine begriffliche Subsumtion fällt, die auf das Vermögen eines transzendental operierenden Subjekts zurückweist. Zwar ist das ›Ding an sich‹ bei Kant unbestimmt, das heißt begrifflos unbegriffen, jedoch ohne es gäbe es keine verstandeskategoriale Abbreviatur durch einen dieses ›Ding an sich‹ bezeichnenden Begriff. Die Crux, die Adorno an Kant festmacht, ist die, dass dieser »mit dem Ding-an-sich an der ›Idee der Andersheit‹ festhalte«32, aber die Vermitteltheit von Subjekt und Objekt ausblende. Die Rehabilitierung der Andersheit, die alles einzelne Seiende für sich hat, ist aber der systematische Ansatzpunkt, den Adorno in der Auseinandersetzung mit Kant reklamiert. Die Negative Dialektik setzt, indem sie den kantischen Vorrang des erkennenden Subjekts und damit dessen begriffliches Subsumtionsbegehren durchstreicht, auf die Erfahrbarkeit der »Verflochtenheit« mit dem Seienden; denn nur so kann ersichtlich werden, »daß alles mehr sei, als es ist«33. In der Auseinandersetzung mit Kant wird der Begriff in seiner Erkenntnisfunktion zurückverwiesen auf das, was ihm unbegrifflich zugrunde liegt: Referenz auf materiale-sinnliche Erfahrungen. Ob diese konstellativ-begrifflich einzuholen sind, bleibt die Kernfrage dieser Abhandlung.
Adornos Kritik an Heideggers Seinsdenken zeigt dessen Leugnung jedes dialektischen Denkens auf. Wird das Seiende in den umfassenden Begriff des Seins völlig eingezogen, verschwindet nicht nur jede Differenz von Sein und Seiendem, es kann auch die Vermittlung von Sein und Seiendem nicht begriffen werden. Das Urteil lautet: »Die Dialektik von Sein und Seiendem: daß kein Sein gedacht werden kann ohne Seiendes und kein Seiendes ohne Vermittlung, wird von Heidegger unterdrückt: die Momente, die nicht sind, ohne daß das eine vermittelt wäre durch das andere, sind ihm unvermittelt das Eine, und dies Eine positives Sein«34. Die Differenz aber, und hier nimmt Adorno das dialektische Denken Hegels ernst, wird ausgetragen, wenn man das Seiende, seine vorgängige Nichtbegrifflichkeit, nicht zugunsten einer identitätsstiftenden Vermittlung aufhebt. Dies jedoch wird durch die positiv bestimmte Dialektik Hegels konterkariert: »Hegel beutet aus, daß das Nichtidentische seinerseits nur als Begriff zu bestimmen sei; damit ist es ihm dialektisch weggeräumt, zur Identität gebracht«35. Während Heidegger die Differenz von Sein und Seiendem ontologisch wieder glättet, indem das Sein das ›mythisch‹ Umfangene ist, geht Hegel zunächst von der Nichtidentität, von der Andersartigkeit des Seienden aus: Es ist unbestimmt und in dieser Unbestimmtheit konstituierendes Moment seiner begrifflichen Identifizierung. Gerade weil das einzelne Seiende (als Einzelnes) eine Negation des umfassenden Ganzen ist, dieses jedoch wiederum – weil das einzelne Seiende Teil des Ganzen ist – eine Negation der Negation bildet, wird das Nichtidentische konstitutives Moment einer Dialektik von Identität; so das hegelsche Diktum: »Wahrhaft ist ohne Nichtidentisches keine Identität«36. Die Dialektik – so Adorno – »trägt die Dialektik des Nichtidentischen nicht aus«; Hegel »eilt darüber […] hinweg«, weil »sein eigener Begriff des Nichtidentischen bei ihm Vehikel« wird, »es zum Identischen, zur Sichselbstgleichheit zu machen«37. Indem das Nichtidentische in seiner dialektischen Verwiesenheit zum Identitätsmoment im identifizierenden Begriff aufgehoben wird, verliert es, was ihm zukommt: seine Unbestimmtheit, seine Bestimmungslosigkeit. Hegel hat zwar die Dialektik von Identität und Nichtidentität entfaltet, jedoch alles Nichtidentische in die Totalität des Identischen zurückgesetzt: eben weil das »Totale bei ihm doch den ontologischen Vorrang an sich reißt. Dazu hilft die Erhebung der Vermitteltheit des Nichtidentischen zu dessen absolut begrifflichem Sein«38. Die Konsequenz ist die begriffliche Zurüstung alles Wirklichen, ist der Denkzwang durch identifizierende Allgemeinbegriffe, »alles qualitativ Verschiedene«39 einzuebnen. Dem anfänglich Widersprüchlichen, Gegensätzlichen, das zwischen dem begrifflichen Denken und den Gegenständen bzw. den Sachverhalten der Welt besteht, wird durch eine Identitätsdialektik der Stachel gezogen. Erst wenn die Dialektik nicht mehr »im Bann des Gesetzes, das auch das Nichtidentische affiziert« steht, wenn sie vielmehr »die vom Allgemeinen diktierte Differenz des Besonderen vom Allgemeinen entfaltet«, dann »gäbe [diese] das Nichtidentische frei, entledigte es noch des vergeistigten Zwanges, eröffnete erst die Vielheit des Verschiedenen, über die Dialektik keine Macht mehr hätte«40. Im kritischen Durchgang durch die Dialektikkonzeption Hegels gewinnt Adorno die Gestalt der Negativen Dialektik, weil in ihr der Begriff des Nichtidentischen zum Angelpunkt wird für den »Nachweis der Insuffizienz einer begrifflichen Bestimmung angesichts des von ihr erfaßten Gegenstandes«41. Zugleich wird das Nichtidentische zum Platzhalter für das Inkommensurable, den unbegrifflichen Rest, der durch die hegelsche »Logik der Denkbestimmungen« ausradiert wird; letztlich »um sie den Sachen überzustülpen«42. Da die hegelsche Begriffslogik die Erkenntnis als begriffliche Fixierung des Realen, des Objektiven, versteht, muss die Programmatik der Kritik der Negativen Dialektik ihre identitätslogische Entsprechung aufbrechen. Nicht, um fälschlicherweise zur reinen Anschauung, zur konkreten Unmittelbarkeit, zurückzukehren, sondern um das Bewusstsein von Nichtidentität, die als referentieller Schatten jeder Begriffsbildung wirkt, in Begriffen gegen den Begriff selbst auszuspielen. Mit der Umwidmung der Begriffsdialektik von Hegel zu einer negativen Dialektik des Begriffs bewegt Adorno sich im kritischen Fahrwasser dessen, was er an der hegelschen Konzeption gewinnt: dass die Negation der Negation nicht zugunsten seiner Positivität gedacht werden muss, sondern als prinzipielle Differenz, die die »absolute Einheit des reinen Begriffs und seiner Realität«43 sprengt. Die Rettung des einzelnen Seienden vor seiner ontologischen Einebnung ins umfassende Seinsgeschick oder seine Glättung durch die Aufhebung seiner Negationskraft qua identifizierenden Begriffs sind die Einsprüche, die Adorno gegen Heidegger und vor allem gegen Hegel formuliert. Dass er dabei nicht beim Gegenstand ansetzt, sondern bei dem Begriff, der diesen zu erfassen sucht, ist der argumentative Ausgang seines kritischen Durchgangs durch die beiden philosophischen Referenztheorien.
Читать дальше