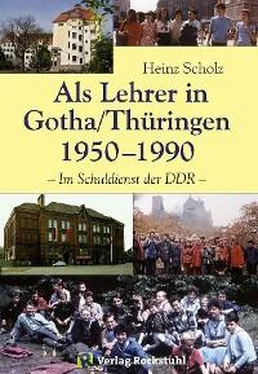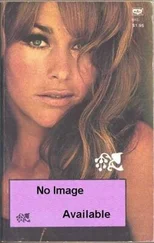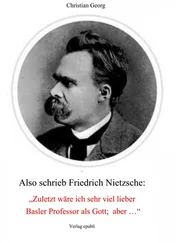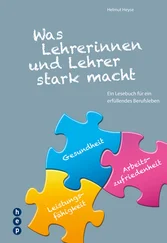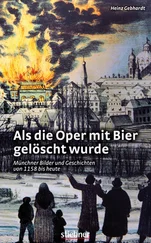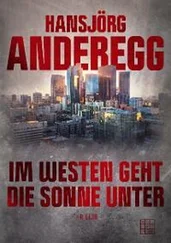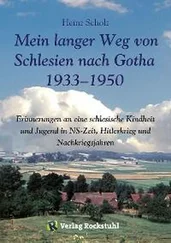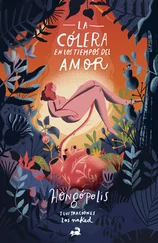Besonders im Fach Staatsbürgerkunde, aber auch in anderen ideologierelevanten Fächern achteten hospitierende Inspektoren oder Fachberater auf mündliche „parteiliche“ Aussagen der Schüler. An solchen „parteilichen“ und „klassenbewussten“ Stellungnahmen der Schüler wurde von versessenen Schulfunktionären oftmals die pädagogische Leistung des Fachlehrers gemessen! Wo sich Lehrer und Schüler gut kannten und verstanden, lernten Schüler mit der Zeit, wenn es darauf ankam, z. B. bei mündlichen Prüfungen, auf den Putz zu hauen und ihre Parteilichkeit vorzuspielen. Ich mochte solch ein Theater nicht.
Wenn man unter „gesellschaftlicher Arbeit“ gemeinnützigen Einsatz und engagiertes Mittun in der Gemeinschaft versteht oder eine positive soziale Einstellung, so wäre dagegen nichts einzuwenden.
Aber allein durch die penetrante Forderung, „gesellschaftliche Arbeit“ unter Beweis zu stellen, erstarrte der Gesichtspunkt Gemeinnutz zu einer formalen ideologischen Floskel. So suchte und sammelte der Lehrer in bestimmten Fällen alle möglichen „gesellschaftlichen Arbeiten“ eines Schülers zusammen, um dem geforderten Kriterium nachzukommen, vor allem aber, um dem Schüler auch unter diesem Gesichtspunkt möglichst Positives ins Zeugnis schreiben zu können.
Der eigentliche moralische Wert gemeinnützigen Verhaltens trat, weil mehr oder weniger erzwungen, in den Hintergrund und hatte im Rahmen der Erziehung einen geringeren Effekt.
So waren „parteiliches Verhalten“ nicht das Recht oder die Aufforderung zu freier subjektiver Meinungsäußerung und die geforderte „gesellschaftliche Arbeit“ nicht im eigentlichen Sinne nur gemeinnützige Tätigkeit, sondern beide Kriterien waren ausgeartet zu wirksamen Mitteln des Zwanges und zur Anpassung. Und wenn beispielsweise ein Mädchen oder ein Junge „nur ein bürgerliches Kind war“, dann sah es sich leicht verführt, sich durch berechnendes „parteiliches“ Auftreten, durch eine betuliche „gesellschaftliche Arbeit“ und durch vorgezeigte Aktivitäten als „Junger Pionier“ so verdient zu machen, dass es bei Schulabschluss eine gute Beurteilung bekam und vom erstrebten Besuch der weiterführenden Oberschule nicht ausgeschlossen wurde. – Der verlangte Beweis von Parteilichkeit verführte zur Heuchelei. Und Heuchelei war und blieb ein negatives Symptom der Schule in der DDR.
Für mich war es als Lehrer unter damaligen Bedingungen wie auch zu allen Zeiten stets die schwerste Aufgabe, eine ehrliche und gerechte, die geistige und psychische Entwicklung des Jugendlichen berücksichtigende Persönlichkeitsbeurteilung schriftlich zu formulieren
Als ich 1950 in der Schule als Lehrer begann, war vorwiegend von antifaschistischer, demokratischer, humanistischer Erziehung die Rede, gemäß dem Gesetz zur Schulreform von 1946. Als Hauptpostulat galt noch „die Erziehung“ … der Kinder und Jugendlichen „zu selbständig denkenden, verantwortungsbewusst handelnden Menschen … “
Bereits 1952 folgten auf Wendungen wie „Erziehung zum Frieden“ oder „ … im Sinne des gesellschaftlichen Fortschritts“ weiterführend die geforderte „Liebe zur Arbeiterklasse“ und der Auftrag „zur sozialistischen Erziehung“; und wir Lehrer mussten nun schon – im Hinblick auf Künftiges – in Konferenzen die „kommunistische Erziehung“ nach sowjetischem Vorbild diskutieren und „lernen“.
Auf dem I. Pioniertreffen 1952 in Dresden, wo dem „Verband der Jungen Pioniere“ der Name „Ernst Thälmann“ verliehen wurde, ist das allgemeine Erziehungsziel so formuliert worden: „Erziehung der Kinder im Geiste des Friedens, der Völkerfreundschaft und des Sozialismus zu bewussten Staatsbürgern der DDR“.
Wer die Schule der DDR durchlaufen hat, wird sich erinnern an politische Programme und Parolen des Verbandes der „Jungen Pioniere“, an „Stufenprogramme“, an die „Gesetze der Jungen Pioniere“, an Blaues Halstuch, Pioniergruß und entsprechende Rituale beim Appell der „Pionierfreundschaft“ in der Schule.
Was ich sagen will: Wenn anfangs dieser Pionier-Verband als Kinderorganisation noch eine nebensächliche Rolle gespielt hatte, so wurde ihm ab 1952 von Seiten der Partei und der Schulbehörden ein ganz wichtiger Platz im Schulleben eingeräumt.
Schule – Elternhaus – Pionierorganisation, diese drei wurden jetzt in dieser Reihe als die wichtigsten Erziehungsträger genannt . Der Kinder- und Jugendverband der „Jungen Pioniere“, nun dem Elternhaus und der Schule als Erziehungsträger nahezu gleichgestellt, war somit erheblich aufgewertet worden, und er sollte künftighin maßgebend die staatsbürgerliche Erziehung der 6 – 14jährigen unterstützen.
In der Folge kamen hauptamtliche Pionierleiter an die Schulen. Lehrer wurden verpflichtet und mussten es als Teil ihrer beruflichen oder „gesellschaftlichen Arbeit“ betrachten, die „Pionierarbeit tatkräftig zu unterstützen“ … Es lief darauf hinaus, dass wir Klassenlehrer sogleich als „Gruppenpionierleiter“ die „Pioniergruppe“ der Klasse zu leiten hatten und regelmäßig „Gruppennachmittage“ organisieren und ausgestalten mussten. Oder wir Lehrer sollten Mütter oder Väter aus der Elternschaft als Gruppenpionierleiter gewinnen, was erfolglos blieb.
Die „Pionierarbeit an der Schule mit Leben erfüllen“ – das war von nun an eine vordringliche Arbeit der Lehrer. Wir wurden also eingespannt und sollten „freiwillig“ den Hauptteil der so genannten „Pionierarbeit“ leisten.
Der eingesetzte Pionierleiter an der Schule war verantwortlich, das Leitungsgremium der „Pionierfreundschaft“ (der ganzen Schule) sowie die Gruppenpionierleiter anzuleiten und die gesamte „Pionierarbeit“ an der Schule programmatisch zu steuern und zu kontrollieren. Er zählte mit zum „Pädagogischen Rat“, wie man die Lehrerkonferenz bald großsprecherisch nannte. So waren wir Lehrer auch dem Pionierleiter gegenüber verpflichtet oder mussten uns mit diesem arrangieren.

Aufmarsch am 1. Mai 1952 oder 1953 in Gotha.
Mehrmals hatten wir einen jungen Mann als hauptamtlichen Pionierleiter an der Schule, zeitweise auch ein junge Frau. Sie wechselten öfter. Meistens versuchte sich der Pionierleiter an die Lehrer anzupassen, war bestrebt, sich mit uns kollegial zu verständigen und uns für die kooperative Mitarbeit zu gewinnen. Ich erinnere mich an zwei dieser Pionierleiter, mit denen wir Lehrer/innen gut zurechtkamen, weil sie nicht wie sture Politfunktionäre auftraten, sondern bemüht waren, vernünftig und nutzbringend die Freizeitgestaltung der Kinder zu fördern und mit uns zusammenzuarbeiten. Eine bei uns eingesetzte Pionierleiterin war völlig unfähig und musste bald abgelöst werden. Einen Pionierleiter wurden wir los, nachdem er mit seiner Pionierkasse nicht korrekt umgegangen war. Von einer anderen strammen Pionierleiterin hielten wir uns möglichst fern, weil sie sich überzogen politisch und autoritär ins Zeug legte.
Manche Lehrer/innen glaubten sich anfangs wehren zu können gegen die ihnen auferlegte „berufsfremde“ Tätigkeit in einer politischen Kinderorganisation. Sie verwiesen auf ältere Jugendliche, auf Oberschüler oder Studenten, die als Gruppenpionierleiter viel besser geeignet seien. Andere fügten sich und führten ihren „Pionierauftrag“ formal aus, ohne viel zu bewirken. Einige standen mit Überzeugung zu ihrer neuen Aufgabe.

Schulveranstaltung zum Tag des Kindes 1953.
Читать дальше