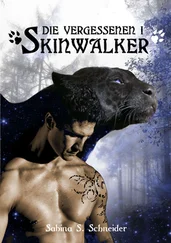Ab 1953 studierte er an der Universität Leipzig und ab 1955 an der Universität Greifswald Medizin, um Militärarzt zu werden. 1958, wenige Wochen vor dem Staatsexamen, wurde Heinz Schneider aus politischen Gründen aus der Nationalen Volksarmee entlassen und zwangsexmatrikuliert. Nach einer „Bewährung in der Produktion“ als Landarbeiter in Blankenfelde erfolgte 1959 die Wiederzulassung als Zivilstudent an der Rostocker Universität, im gleichen Jahr Staatsexamen an der Greifswalder Universität, 1962 Promotion bei Prof. Dr. Gerhard Mohnike zum Doktor der Medizin mit einer Arbeit zu Dosis-Wirkungsbeziehungen des Insulins. Nach Beendigung der internistischen Facharztausbildung 1967 erfolgte die Subspezialisierung für Diabetologie. Von 1967 bis 1998 leitete Heinz Schneider als Chefarzt die Diabetesabteilung des Kreiskrankenhauses Prenzlau. Während der politischen Wende war er Abgeordneter des Prenzlauer Kreistags und leitete den Sozialausschuss. Für seine Verdienste in der Forschung und Diabetikerschulung wurde Heinz Schneider 1999 mit der Gerhardt-Katsch-Medaille, einer hohen Auszeichnung auf dem Fachgebiet, geehrt.
Widmung
Kay Blumenthal-Barby gewidmet
Vorwort
Die politisch motivierte Exmatrikulation von der Universität Greifswald im Jahre 1958, die ich noch heute als ungerecht empfinde, schnitt in meine Seele eine tiefe, bis heute nicht heilende Wunde. Man sagt, die Zeit heile alle Wunden. Das mag sicher auf die Mehrheit meiner Mitbürger zutreffen. In mir heilte die noch immer schmerzende Verletzung jedoch nicht aus. Allerdings half mir die Aufzeichnung meiner Lebensgeschichte bei der Milderung dieses Dauerstresses, der mich über zwei Drittel meines ansonsten schönen und unbeschwerten Lebens als Arzt und Rentner begleitet.
Für eine gewisse Zeit hatte ich die DDR durchaus als „meinen Staat“ betrachtet. Ich beschreibe lediglich die Fakten, so wie ich sie – oft besonders drastisch – erlebt habe, versuche, jede Einseitigkeit zu vermeiden, und will auch nicht vergessen, dass mir hier als typischem Kind einer Arbeiterfamilie ein qualitativ hochwertiges Studium, wenn auch unter ungerechtfertigten Schwierigkeiten, ermöglicht wurde, für das weder meine Eltern noch ich je einen Pfennig zu bezahlen brauchten. Doch auch sie litten erheblich unter den damaligen brutalen Geschehnissen, die mich zu einer „Bewährung in der Produktion“ als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft geführt hatten, während gleichzeitig in diesem Land ein erheblicher Ärztemangel bestand.
Nur wenige Wochen trennten mich damals vom Beginn des medizinischen Staatsexamens, das von Vertretern der Staatsmacht zunächst in eine ungewisse, mehr oder weniger ferne Zukunft verlegt wurde. Somit möchte ich aus meiner persönlichen und damit sicher subjektiven Sicht daran erinnern: Vieles war absurd, was damals als „normal“ galt. Das Misstrauen des nicht vom Volke gewählten, lebensfremden Politbüros der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), das sich eine „führende Rolle“ anmaßte, war nach meiner Auffassung der Hauptgrund für den Untergang des sogenannten „Arbeiter- und Bauernstaates“, der als Diktatur einer einzigen Partei niemals demokratisch legitimiert gewesen war.
Ich selbst habe noch den Untergang des Dritten Reiches erlebt und mich immer als „Deutscher“ und niemals als „DDR-Bürger“ gefühlt, auch nicht, als ich in meiner frühen Jugend vorübergehend glaubte, in der DDR eine echte Heimat gefunden zu haben. Mir wurde bald klar, dass dieser Staat nichts anderes war als ein Produkt der Siegermacht Sowjetunion und ihrer von dort heimgekehrten Vasallen und somit nicht das Recht hatte, für alle Einwohner dieser später eingemauerten Gemeinschaft ein wahrhaftiges Vaterland zu sein. Insofern war ich unendlich froh und überglücklich darüber, dass durch die friedliche Revolution in der DDR und die dadurch ermöglichte Wende der Weg für die Wiedervereinigung Deutschlands geebnet werden konnte. Noch heute freue ich mich täglich über dieses einmalige, zu einer echten Demokratie führende historische Ereignis, das man mit Recht als ein Wunder der Geschichte, welches ohne Blutvergießen zustande kam, bezeichnen kann.
In meinen Aufzeichnungen werden öffentliche Personen von mir namentlich genannt, ebenso alle Personen, mit denen mich eine bleibende positive Erinnerung verbindet. Alle anderen – selbst der ungerechte Parteisekretär meines Studienjahres und auch die namentlich in den Urkunden genannten Mitarbeiter der Staatssicherheit – werden von mir anonymisiert, denn es geht mir nicht darum, Vergeltung zu üben. Die Decknamen der Inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit (IM) habe ich beibehalten.
Mahlow, Mai 2011
Heinz Schneider
Vorwort zur zweiten Auflage
Nach dem Erscheinen der ersten Auflage teilten mir mehrere Leser ihr eigenes Schicksal in der DDR mit. Durch diese partiell gravierenden Berichte erfuhr ich mit Betroffenheit, dass es viel schlimmere Schicksale gab als meines. Leider sind diese Bücherfreunde jedoch bisher nicht bereit, ihren Lebensbericht zu veröffentlichen. Aus Gründen des gegenseitigen Vertrauens bin ich darüber zum Schweigen verpflichtet. Ihre Schilderungen bestätigen mir jedoch indirekt, dass es sicher sinnvoll war, zumindest meine persönlichen Erfahrungen Interessierten mitzuteilen und als Verbuchtes für die Nachwelt festzuhalten, obwohl ich als Sohn eines Altkommunisten – trotz meines Nonkonformismus – sicher noch immer als ein Privilegierter galt. Denn nach meiner ungerechtfertigten „Bewährung in der Produktion“ konnte ich Diabetologe werden und als langjähriger Chefarzt – wenn auch unter unangebrachten Schwierigkeiten und Schikanen – meinen Berufswunsch in der DDR realisieren.
Einige Leser stellten in meinen Schilderungen eine mir selbst nicht bewusste hintergründige Ironie fest. Sie baten mich, aus meiner Studenten- und Berufszeit noch einige unpolitische Anekdoten beizusteuern, ein Wunsch, den ich meinen Lesern gerne erfülle.
Mahlow, d. 31.10.2014
Heinz Schneider
Früheste Kindheitserinnerungen
Zu meinen ersten Erinnerungen zählt ein Erlebnis, vermutlich aus dem Jahr 1937, das sich in meinem zweistöckigen Geburtshaus in der Fleischergasse 118 in Schlackenwerth im Egerland zugetragen hatte. Eilig war ich zwischen dem ersten Stock und dem Erdgeschoss um eine haarnadelartig angeordnete Treppenkurve durch eine Glastür marschiert, die prompt in hundert Stücke zerschellte, ohne dass mir etwas passierte. Seitdem galt ich im Kreise meiner Familie als ein „geborener“ Dickschädel, denn mein Kopf hielt wohl schon in der frühen Kindheit viel aus, wie daraufhin öfter behauptet wurde. Das traf offenbar nicht nur auf den knöchernen Schädel zu, sondern auch auf den Charakter. Hatte ich mich erst einmal zu einer festen Meinung durchgerungen, war ich davon nur schwer wieder abzubringen. Insofern hatten es manche Zeitgenossen mit mir nicht leicht und mich ständig anzupassen, fiel mir sichtlich schwer. Damit waren Schwierigkeiten in meinem künftigen Leben, das durch zwei Diktaturen geprägt werden sollte, vorprogrammiert. Und zum Wendehals war ich nicht geboren.
Meine Mutter erzählte mir, dass ich bereits mit knapp vier Jahren die Uhr gekannt und so das Erstaunen eines Hausarztes Dr. Wehner in meiner Heimatstadt ausgelöst hätte, der im Beisein vieler Patienten sein Chronometer immer wieder verstellt hätte, ohne dass ich ihm je eine falsche Zeitangabe lieferte. Doch daran kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.
Anders verhält es sich hingegen mit einem sogenannten „Kommunistenfest“ in Chodau westlich von Karlsbad, zu dem mich Vater und sein Gesinnungsfreund Paul Leicht mitnahmen. Vor vermutlich Hunderten von Teilnehmern sprach ein aus dem Altreich (Synonym für das Deutsche Reich) stammender Kommunist, der offenbar aus der Sowjetunion eingereist war, über die besorgniserregende Entwicklung des Nationalsozialismus in Deutschland. Zum ersten Mal sah ich Abbildungen von vier bärtigen Männern, wahrscheinlich Marx, Engels, Lenin und Stalin. Als Geschenk erhielt ich ein mit einem Sowjetstern (Symbol der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei) versehenes rosarotes Zelluloidschild mit einem Gummiband um den Hinterkopf, sodass ich alles in einem rosaroten Licht sehen konnte. Dieser optisch gefällige Eindruck entwickelte sich für mich jedoch zu keinem Dauerzustand, denn später, als ich aufgefordert wurde, alles in dieser Farbqualität zu sehen, konnte ich verschiedene Farben sehr gut differenzieren. Somit litt ich nicht an jener politischen Blindheit, die in Diktaturen gerne von den Staatsbürgern erwartet wird.
Читать дальше