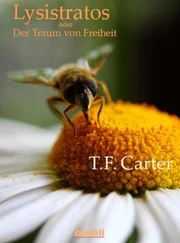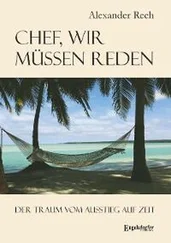Der Mond scheint hell ins Zimmer. Deine Haare sind dir ins Gesicht gefallen, und du liegst mit ausgebreiteten Armen auf dem Teppich. Deine weißen Knie schauen unter deinem engen schwarzen Rock hervor. Ich stütze mein Kinn auf meine Knie, schließe die Augen. Finde keinen Schlaf. Ich stehe auf, gehe auf und ab. Auch in der besagten Nacht hab ich kein Auge zugetan. Schlimmer noch, damals konnte ich mich nicht mal hinsetzen, und schon gar nicht auf und ab gehen. Euer Zimmer war winzig, und ihr habt alle tief und fest geschlafen.
Die ganze Nacht hindurch, bis in die frühen Morgenstunden, war ich mehrmals zu Mehrdads Haus gegangen, mit einem kleinen Kanister Benzin unterm Arm.
Tröstlich das Wissen um diesen Kanister und um die Streichhölzer in meiner Tasche. Wie ich’s geschafft habe, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich immer wieder an meinen Ausgangspunkt zurückgegangen und dann aufs Neue losgezogen bin. Als ich diesmal die Straße vor seinem Haus hochgehe, habe ich einen großen Kanister Petroleum dabei. Ich trage meinen ziegelroten Mantel und habe mir meinen Schal ins Gesicht gezogen. Kurz vor Mehrdads Haus, als ein fiktiver Regisseur „Cut!“ ruft, mache ich kehrt und breche kurz darauf erneut auf. Als ich wieder am Ziel bin, gieße ich mein Petroleum endlich über sein zufällig draußen geparktes Auto. Die Flammen greifen rasch um sich, und ich muss schnell entscheiden, wen sie erfassen sollen. Seine Mutter ist zwar schuld an allem Übel, aber der Brautschleier brennt besser. Während eine der beiden Frauen in Flammen steht, gehe ich draußen die Straße hoch. Müde, lebensmüde, will ich mich jetzt selbst verbrennen. Kurz bevor ich mich mit Petroleum übergieße, stecke ich den Kopf unter die nach Wolle riechende dicke Decke, mit der du mich zugedeckt hast, und weine. Ich habe Mehrdad vor Augen. Er fährt mir mit der Hand durchs Haar, lässt die Hand in meinem Nacken ruhen und sagt in seiner unverblümten Art: „Du brauchst kein Feuer. Du brennst doch schon, als meine Flamme.“
Gern würde ich die hochnäsige Visage seiner Mutter beim Anblick dieser Katastrophe wie eine spröde Maske zerspringen und ihre Hände zittern sehen. Doch mein Traum endet jedes Mal wie ein Dokumentarbericht, mit Sirene und Friedhof. Wie es nach dem Brand weitergeht, male ich mir nie aus. Ich sterbe in diesem Moment, und was danach geschehen mochte, war unwichtig. Forough kommt mir in den Sinn, die gesagt hat: „Wenn ich tot bin, werft mich ins Plumpsklo.“
Selbst mein Versuch, mir mich im Brautkleid vorzustellen, misslingt. Ich will nicht mal mehr, dass der gut aussehende Arzt im Spital, in dem ich tätig bin, zu mir ans Krankenbett kommt. Der Arzt, der immer blank geputzte Schuhe trägt und mir im Traum erscheint, wenn ich ihn brauche, wie gerufen. Was mir überdies die Freude einiger staunend offener Münder beschert.
Mehrdad hat meine Arbeit im Krankenhaus immer als nichts Besonderes bezeichnet. Ich hatte eingewandt, dass ich sie gern mache und, in Anlehnung an Djawids Postulate, wirtschaftliche Unabhängigkeit ins Feld geführt. Darauf war Mehrdad nicht näher eingegangen. Er hat mich nur angeschaut. Asche auf mein Haupt! Weil mir immer erst nach sechzig Jahren ein Licht aufgeht! Ich hatte unnötig viele Worte gemacht. Mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt? Heute weiß ich, ohne das Interesse, ohne ein Echo deines Gegenübers sind selbst die klarsten Worte nur undefinierbare, bedeutungsleere Geräusche.
Gegen Morgen bin ich wach geworden, hab mich im Bett aufgesetzt, mich im Zimmer umgeschaut. Ihr beiden wart hinter der Schiebetür, jenseits von mir. Ich brauchte einen Moment, um die Ereignisse der letzten Nacht mit mir und meinem leblosen Körper in Verbindung zu bringen. Warum war ich zu euch gekommen? Ich hätte dorthin gehen müssen, wo mein Schmerz Bedeutung gehabt und ich keine so große Distanz zu meinen Mitmenschen gespürt hätte. Ich konnte ihn sehen, ihn berühren, umarmen als den fortan unerreichbaren Liebsten, und konnte an seinem Schmerz sterben.
Ich faltete die Bettdecke zusammen, schulterte meine Tasche und ging leise aus dem Haus.
Du stöhnst im Schlaf. Ich gehe zu dir ans Bett und berühre deine Hand. Sie ist warm, anders als sonst. Warm, wie damals im Bus, als du meine Hand gedrückt hast. Damals waren wir unterwegs zum Basar. Auf deinen Vorschlag hin. Du hast ununterbrochen geredet. Und als wir ins Gedränge geraten sind, hast du nicht gesagt „lass uns umkehren“. Vor jedem Laden, vor dem ich stehengeblieben bin, hast auch du Halt gemacht. Hast mich nicht „Trödeltante!“ genannt. Hast dich nicht ständig um „Die Kinder, die Kinder!“ gesorgt, hast nicht mit deinem Geglucke genervt.
Mama hat erzählt: „Ich war an dem Abend, als Schiwas Schmerzen angefangen haben, zu Besuch bei den beiden. Sie haben sich seelenruhig angezogen und gesagt, sie fahren jetzt ins Krankenhaus, allen Ernstes. Ich war baff. Dass ich ruhig schlafen gehen soll, haben sie mir noch gesagt. Und ich dachte, sie fahren vielleicht ins Krankenhaus und klauen sich ein Baby. So wie die beiden hab ich jedenfalls noch niemanden zu einer Geburt aufbrechen sehen.“
Auch um Djawid hast du dich nicht gesorgt. Du hast dir überhaupt um niemanden Sorgen gemacht. Hast all die Stoffe berührt, die auch ich schön fand, und einmal hab ich mitbekommen, wie eingehend du eine Kristallschüssel betrachtet hast.
Mit dir wird Einkaufen auf dem Basar zum Vergnügen. Weil du in dem großen Markt mehr siehst als einen Ort, an dem man einkauft. Mehr als bloß eine Ansammlung von Läden, die zwar alle gleich aussehen, sich aber in ihrem Warenangebot stark unterscheiden. Dir liefert das Basargewimmel viele fantasieanregende Rätsel, und du bist nie als gewöhnliche Kundin unterwegs, sondern als Forschungsreisende und stößt im Zuge deiner Erkundungstouren auf Amüsantes, Erstaunliches, Skurriles. Auf den Verkäufer, der vergessen hat, den Reißverschluss an seiner Hose zuzumachen. Auf die Frau, die jemand den Stoffhändlern zum Vergnügen zugeteilt hat. Dir fällt der an einer Ladentür baumelnde Waschlappen ins Auge, und du hast Mitleid mit einer in all dem Überfluss stark abgemagerten Katze.
„Ich muss ein paar Sachen für Forough besorgen“, hast du gesagt. „Sie hat sie bestellt. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, erinnert sie mich dran.“
„Warum hast du das Zeug nicht längst gekauft?“
„Für mich selbst kaufe ich sowas einfach im Laden bei uns um die Ecke, das dauert keine zwei Minuten. Madame aber findet das Zeug von dort untauglich.“
Eine Miederwarenverkäuferin hatte Büstenhalter bündelweise auf ihrem Ladentisch aufgereiht.
„Du bist ja keine Frau“, hab ich gefrotzelt.
Mama hat immer gesagt: „Selbst ich, ihre eigene Mutter, hab sie bis heute nicht ohne Kleider gesehen. Und immer hat sie Strümpfe getragen. Nicht mal vor dem Schlafengehen hat sie sich was Leichteres angezogen. Wohl für den Fall, dass sie irgendwann mal mitten in der Nacht raus auf die Straße muss.“
Ich schlafe gern nackt, im Gegensatz zu dir. Wenn meine Angst vor plötzlichen Erdbeben nicht wäre, würde ich auch mein Négligée noch ausziehen. Ich mag das Gefühl der rauen Decke auf meiner weichen Haut, wenn ich mich im Bett wälze.
„Aber Forough ist eine“, hab ich gesagt. „Jedenfalls fraulicher als du.“
„Bloß weil sie zwei Beutel Buttermilch um den Hals hat?“, hast du gekontert.
Ich musste lachen. Jedes Mal, wenn Forough mich sieht, sagt sie: „So eine tolle Figur. Ruinier sie dir bloß nicht.“ Dann legt sie sich die Hand auf die Brust, zwinkert verschmitzt vielsagend: Vollbusig kommt nie aus der Mode.
„Sie brüstet sich allzu gern damit“, fand ich.
„Jedes Mal, wenn sie mich sieht, umfasst sie ihre beiden Prachtstücke wie die Köpfe von Zwillingskindern, drückt sie und behauptet, sie würde sie jederzeit gegen so flache wie meine eintauschen.
Читать дальше