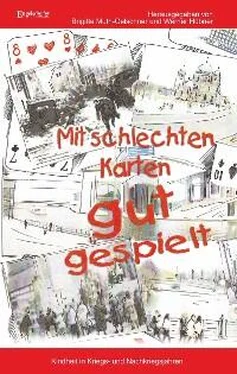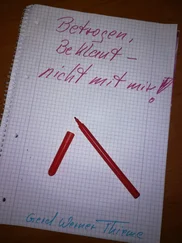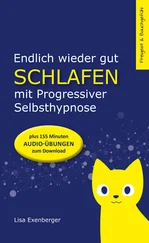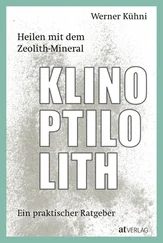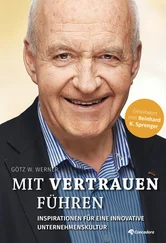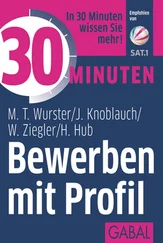Mutter organisiert unser Leben
Wir besuchten auch die Großmutter und zwei Tanten in Mutters Geburtsort Tichau, die erzählten, welchen Schikanen sie ausgesetzt seien. Inzwischen hatte Mutter auch erfahren, dass Vater auf dem Weg nach Berlin geschnappt worden war und nun bei einem polnischen Bauern arbeitete. Mutter traf ihn dort, und die beiden kamen überein, so schnell wie möglich in den Westen zu fliehen.
Im Mai 1946 machte sie unser Mitbewohner, der wie bereits erwähnt, in der polnischen Verwaltung arbeitete, darauf aufmerksam, dass nur noch zwei Transporte in die englische Besatzungszone fahren würden, alle weiteren nur in die russische Zone. Mutter hätte auch die Möglichkeit gehabt, die polnische Staatsangehörigkeit zu erwerben, lehnte dies aber ab. Nun wurde schnell gepackt und die Ausreise beantragt.
Das Jahr in Polen hatten wir überlebt. Bevor der Zug, der uns in den Westen nach Marienborn bringen sollte, sein Ziel erreicht hatte, wurde das Gepäck mehrmals gefilzt. Endlich im Westen, hatten wir die Wahl zwischen dem Kreis Peine und der Stadt Wolfenbüttel. Mutter entschied sich für Peine, weil sie sich erinnerte, dass es dort Industrie gab. Das war für sie wichtig, weil sie sich sagte, wo Industrie ist, ist auch Arbeit.
Unsere neue Bleibe war in Ölsburg. Mutter und meine Schwester bekamen ein Zimmer zugewiesen, für mich selbst gab es keinen Platz mehr. Ich wurde in der Nachbarschaft untergebracht.
Mutter, durch und durch Geschäftsfrau und überaus diplomatisch, machte rasch eine Miniwohnung für uns ausfindig, in der es sogar ein Bettgestell, einen Tisch, einen Küchenschrank und einen Herd gab, der mit Torf beheizt wurde. Ein Wasserhahn befand sich in einem kleinen Nebenraum, das WC auf dem Hof.
Zwar hatten wir Geld, das aber wertlos war. Uns blieben zum Tauschen nur Zigaretten, die wir auf den Lebensmittelkarten bekamen, aber nicht benötigten, da Mutter nicht rauchte.
Wenn Mutter bei einem Bauern half, gab es etwas Gemüse. Im Herbst suchten wir die abgeernteten Felder nach liegen gebliebenen Ähren ab, ebenso die Kartoffeläcker. Etwas später im Jahr wurden Bucheckern gesammelt, für die man Öl bekam. Wenn die Erntewagen mit Zuckerrüben zur Fabrik fuhren, fielen manchmal einige herunter, die rasch aufgesammelt und zu Rübenkraut verarbeitet wurden. In diesem Jahr lernte ich den Hunger kennen.
Lernen und selbstständig werden
1947, nach den Sommerferien, konnte ich in die Oberschule in Peine fahren. Eine sehr nette Klassenlehrerin erleichterte mir das Einleben und gab mir Nachhilfe in Französisch, einem Fach, das ich bis dahin nicht hatte.
Unsere Mutter hatte längst herausgefunden, dass unser Vater in Halle lebte und arbeitete. So machte sie sich insgesamt zweimal auf die Reise, einmal bis Helmstedt mit dem Zug, dann zu Fuß über die grüne Grenze und dann wieder mit der Eisenbahn nach Halle, alles in allem ein abenteuerliches und gefährliches Unternehmen. Offensichtlich fiel es unseren Eltern schwer zu entscheiden, ob wir zu Vater in den Osten gehen oder Vater zu uns in den Westen kommen sollte. Schließlich entschieden sich die Eltern für den Westen. Dies war ein Glück für mich, denn ich erinnere mich, dass ich damals fest entschlossen war, im Westen zu bleiben.
Nun war die Familie wieder vereint. Der Zufall half, dass die Eltern eine leer stehende Bahnhofsgaststätte entdeckten und diese dank hilfsbereiter Menschen auch übernehmen konnten. Die Anfangsbedingungen waren für uns recht günstig. Das Mobiliar war noch vorhanden, das Brennmaterial stellte das Industrieunternehmen, dem das Gelände und die Bahnanlage gehörten. Das war mehr als ein Lottogewinn, denn wir und die Reisenden hatten warme Räume. Zu essen gab es auch. Aus Fleischknochen und viel Suppengrün wurde unendlich viel Brühe gekocht, die allen schmeckte. Geschirr war zwar mittels Zigaretten und hilfsbereiter Menschen beschafft worden, ich erinnere mich aber, dass immer sehr schnell abgeräumt und gespült werden musste, weil die Teller sofort wieder gebraucht wurden. Natürlich bestand auch die Gefahr des Klauens.
In diesen Nachkriegsjahren fand ich Anschluss in der katholischen Pfarrjugend, die ich bald im Jugendring, damals der Zusammenschluss aller Jugendverbände der Stadt, vertrat. Als die englische Militärregierung ein sozialpolitisches Seminar anbot, konnte ich daran teilnehmen und war begeistert. Ich denke, dass dort der Grund für mein soziales Engagement gelegt wurde, aber auch das Interesse an sozialpolitischen Themen sowie die Ablehnung autoritärer Strukturen.
Kein Studium, dafür aber Stipendium
Die Zeit nach dem Ende des Dritten Reiches mit ihrer bitteren Not, dem vielfältigen Mangel hat ihre Spuren hinterlassen. Flüchtlinge genossen keine Wertschätzung, sie hatten ja nichts vorzuweisen, und Geld war nichts wert. Es fehlten Freunde, Bekannte und Verwandte.
Ein Studium kam für mich nicht in Betracht. Die raren Ausbildungsplätze an den Universitäten waren den Kriegsheimkehrern vorbehalten, und die Wartelisten waren lang. Im Übrigen fehlte es mir auch an Antrieb. Über mancherlei Umwege kam ich zur Erwachsenenbildung und lernte in einer Fortbildung für soziale Gruppenarbeit Prof. Dr. L. Lowy kennen. Nun steckte ich meine ganze Energie in das dreijährige berufsbegleitende Studium „Soziale Gruppenarbeit und Supervision“. Soziale Gruppenarbeit schien mir eine ideale Form zu sein, soziales Verhalten anzuregen und einzuüben. Allerdings gehörte Supervision, auch Praxisberatung genannt, nur bedingt dazu. Ein Netzwerk gab es damals noch nicht. Ich ergriff die Chance, eine Supervisionsausbildung zu übernehmen bzw. neu zu gestalten.
Geprägt von der starken Mutter
Wenn ich heute an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, haben mich insbesondere Flucht, Vertreibung, Neuanfang und nicht zuletzt das Elternhaus geprägt. Innerhalb von Minuten alles Bekannte, Haus, Umgebung und Freundinnen verlassen zu müssen, war abenteuerlich. Alles änderte sich. Es gab keine feste Unterkunft, keine geregelten Mahlzeiten. Das regelmäßige Waschen, Zähneputzen, Wechseln der Unterwäsche und der Kleider erfolgte nur sporadisch. Es gab Zeit im Überfluss. Denn zum Lesen fehlten die Bücher und zum Spielen die gleichaltrigen Kinder. Neu war die ständige Anwesenheit der Mutter. Sie informierte sich über die jeweilige Situation und handelte danach.
Die Tschechoslowakei verließen wir so schnell mit der Bahn, weil sich absah, dass der Krieg bald enden würde und Mutter die Wut der Bevölkerung in den besetzten Gebieten voraussah. Sie merkte auch bald, dass wir bei der nächsten Anlaufstelle, der Familie meines Onkels väterlicherseits, unerwünscht waren und zog mit uns weiter. Sich informieren, überlegen, handeln .Wenn ich heute zurückdenke, stelle ich immer wieder fest, dass meine Mutter in dieser chaotischen Zeit Enormes geleistet hat.
Daraus habe ich für mich den Kernsatz abgeleitet: Nicht jammern und die Hände in den Schoß legen, sondern überlegen und handeln. In der Weiterführung heißt das, Erwachsene sollten für Heranwachsende Vorbild sein.
Ein anderes Stichwort heißt Verantwortung übernehmen. Vermutlich hätte ich die beschriebenen schwierigen Situationen nicht so gut überstanden, ohne die innere Geborgenheit, die eine starke Mutter gibt.
Dies möchte ich noch einmal an zwei Beispielen verdeutlichen: Auf dem Rückweg nach Gleiwitz mussten wir in einem leer stehenden Bauernhaus übernachten. Am nächsten Morgen machte Mutter Feuer im Herd, um Kaffee zu kochen. Auf einmal ertönten von draußen Männerstimmen .Mutter flüsterte mir zu: „Macht, dass ihr in den Garten kommt. Versteckt Euch hinter Sträuchern, aber lauft nicht vom Haus weg, ich komme wieder“. Tatsächlich nahmen die Russen sie mit, zum Arbeiten. Ängste zu zeigen, war nicht möglich, im Gegenteil, ich musste ja auf meine dreijährige Schwester aufpassen und sie beruhigen. Irgendwie war wohl die Gewissheit da, dass Mutter zurückkäme. Gegen Abend kam sie dann auch. Wir übernachteten noch in dem Haus und verschwanden am nächsten Morgen.
Читать дальше