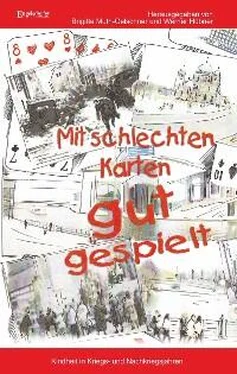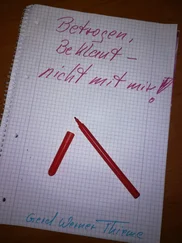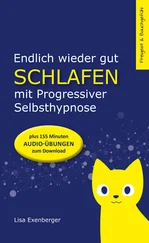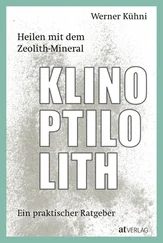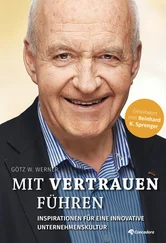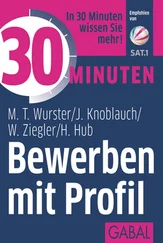Als Kind war ich viel allein. Am wichtigsten war für mich eine Tante, die bei uns im Haus lebte und vor allem auch arbeitete. Sie hatte jedoch einen Makel, sie war nämlich verheiratet gewesen und geschieden worden. Ich jedoch mochte sie so sehr, dass ich sie „Tante Mutti“ nannte. Von ihr fühlte ich mich geliebt. Bis zum Schuleintritt war ich nach Aussagen meiner Tante, die mich betreute, mehr krank als gesund. Masern, Scharlach, Keuchhusten haben sich abgewechselt und mir sehr zugesetzt. Ich musste ja krank werden, um Zuwendung zu bekommen.
Als die Schulzeit begann, wurde ich mit einer Schiefertafel, an der ein feuchter Schwamm und ein trockenes Tuch hingen, sowie mit einem Griffel ausgestattet. Eine Schultüte mit Obst und Süßigkeiten wie die anderen Kinder hatte ich nicht. Ich beneidete sie heftig darum. Der Kommentar meiner Eltern dazu lautete: „Du bekommst Obst und Schokolade zu Hause, die anderen brauchen nicht zu sehen, was es bei uns gibt“. Weil wir eine Gaststätte hatten, gab es sicherlich mehr als bei anderen.
Sich zurückhalten war wichtig
Der Kriegsbeginn ist für mich mit dem Überfall polnischer Soldaten auf den Gleiwitzer Sender verbunden. Wie es sich damit wirklich verhielt, habe ich erst viel später erfahren. Was ich damals lediglich mitbekam, waren vielsagende Blicke, die sich die Erwachsenen zuwarfen, das Getuschel der Verwandten und der Nachbarn oder aber, wenn wir Kinder anwesend waren, für mich unverständliche Worte. Wenn der Nachwuchs oder sogar Fremde zuhören konnten, wurde nämlich bei uns immer Polnisch gesprochen.
Erinnern kann ich mich noch an das Brennen der Synagoge und an die geplünderten Geschäfte, in denen wir oft eingekauft haben. Noch immer habe ich das Bild einer Flammenwand vor Augen. Die sogenannte „Kristallnacht“ am 9. November 1938 wurde von den Erwachsenen totgeschwiegen .Was das alles zu bedeuten hatte, wusste ich nicht, dafür aber umso deutlicher, dass ich nicht fragen durfte. In meiner Familie wurde ganz einfach „Zurückhaltung“ verlangt. Meine Fragen hätten die Eltern nur sehr ärgerlich gemacht. Dabei wollte ich soviel wissen .Ich empfand großes Mitgefühl für das jüdische und polnische Volk. Es gab jedoch niemand, der mir meine Fragen hätte beantworten wollen.
Eines Tages wurde mein zucker- und nierenkranker Vater doch noch eingezogen .Er wurde zu einer Einheit in Maastricht abkommandiert. Es dauere aber nicht lange ,und er kehrte wieder zurück. Als wehruntauglich eingestuft, musste er bei der Reichsbahn arbeiten. Von Hunger, Kälte und Luftangriffen hatten wir bis Januar 1945 noch nichts gespürt.
Dann hingegen veränderte sich unsere Welt. Der Januar war sehr kalt, es lag sehr viel Schnee. Auf der Straße sah ich einen nicht enden wollenden Zug von Elendsgestalten vorbeiziehen, angetrieben von Männern in Gefängniskleidung. Auch über diese Menschen wurde nicht gesprochen. Allerdings hörte ich aus dem Getuschel das Wort „Auschwitz“ heraus. Inzwischen hatte ich bereits gelernt, dass ich wie alle anderen wegschauen musste. Für mein Mitgefühl blieb auch hier kein Raum.
In meiner Familie waren materielle Dinge wichtig. Meine Mutter übernahm die Führungsrolle, mir gegenüber war sie auch immer sehr streng. Beispielsweise quälte ich als Backfisch meine Mutter mir zu erlauben, mir beim Friseur Dauerwellen legen zu lassen. Natürlich war alles Betteln vergeblich.
Einige Tage später musste ich mich abends warm anziehen .Meine dreijährige Schwester wurde dick eingepackt, und die ganze Familie lief zu einem großen Platz. Mutter hatte aus einem stabilen Stoff so etwas wie Rucksäcke genäht, die wir nun mitnahmen.
Bevor wir losgingen, hörte ich wie ein Gast zu meinem Vater sagte: „Das ist ja nicht zu fassen, dass Frauen und Kinder noch hier sind. Der Russe steht bereits kurz vor Gleiwitz, und Züge verkehren nicht mehr. Es fährt aber noch ein Bus in den Westen, bring Deine Familie zum Bus!“ Nach einer längeren Wartezeit kam dann tatsächlich ein Bus, der eigentlich nur für schwangere Frauen bestimmt war .Wir durften aber trotzdem einsteigen. Vater blieb zurück.
Der Bus fuhr bis Ratibor. Bei einer Tante, die Beamtin beim Fernmeldeamt war, konnten wir zwei, drei Tage bleiben, dann ging es weiter auf einem Pferdewagen bis Olmütz. Die Straße war voller Menschen, die sich mühsam mit ihrem Gepäck fortbewegten – und auch hier wieder ein bewachter Zug von Elendsgestalten. Ich sah, wie plötzlich zwei von ihnen aus der Gruppe ausscherten und auf ein freies Feld zuliefen. Dann krachten Schüsse. Einer der Männer fiel zu Boden.
In Olmütz wurden wir in einer Schule untergebracht, aber schon nach kurzer Zeit mussten wir weiter. An den nächsten Ort kann ich mich zwar nicht erinnern, jedoch höre ich meine Mutter noch sagen, wir müssten so schnell wie möglich hier weg, denn wenn der Krieg aus sei, gehe es den Deutschen hier schlecht.
Auf Umwegen gelangten wir ins Erzgebirge und über Annaberg in den kleinen Ort Schönheide, wo wir zunächst einmal blieben. Hier fand uns auch unser Vater wieder, der ja Kriegsdienstverpflichteter bei der Reichsbahn gewesen und in Halle gestrandet war. Nun beschlossen die Eltern, zurück nach Gleiwitz zu gehen. Sie organisierten einen kleinen Leiterwagen, in den meine Schwester gesetzt sowie das wenige Gepäck verstaut wurde, und dann ging es zu Fuß in Richtung Osten.
Wir kamen durch das zerstörte Dresden, in dem es nur so von russischem Militär wimmelte. In dem Ort, den wir gegen Abend erreichten, übernachteten wir auch, meistens bei Bauern, denn Hotels, Gasthäuser, Pensionen waren längst geschlossen. Natürlich hatten auch die Bauern Angst, dass sie bald ihre Heimat verlassen müssten.
Je weiter wir in den Osten kamen, desto leerer waren die Straßen, umso verlassener die Dörfer. Bald kam im Treck, dem wir uns angeschlossen hatten, das Gerücht auf, dass die Männer alle in Gefangenschaft kämen. So blieben diese zurück, nur Frauen und Kinder zogen weiter. Ich hatte bei den Eltern aufgeschnappt, dass Vater vorhatte, nach Berlin zu gehen. Dort lebte einer seiner Brüder, von dem sich Vater Informationen erhoffte.
Mutter gelangte mit uns Kindern tatsächlich bis nach Gleiwitz. Unser Haus samt Gaststätte waren besetzt. Unsere Hausangestellte hatte jedoch einige Sachen gerettet, die Mutter im Laufe der Zeit gegen Lebensmittel eintauschte. Bis Mutter bei einer guten Bekannten eine dauerhafte Unterkunft für uns bekommen hatte, verbrachten wir die Tage auf einem Bauernhof und schliefen auf dem Heuboden.
Die Wohngemeinschaft bestand aus drei Frauen, zwei Männern und uns zwei Kindern. Der Lebensunterhalt wurde gemeinsam bestritten. Von einem der beiden Männer, der in der polnischen Verwaltung arbeitete, bekamen wir wertvolle Tipps. Die anderen Erwachsenen arbeiteten in einer Nähstube für die Russen, wo sie hauptsächlich Uniformen ausbesserten. Wer von den anderen Frauen Zeit hatte, half bei dieser Arbeit. So kamen wir an Brot und andere Lebensmittel. Hunger mussten wir nicht leiden. Zwar lebten wir von der Hand in den Mund, aber die Keller und Speisekammern der leer stehenden Häuser waren ja gut gefüllt. Außerdem wurde auf dem schwarzen Markt verkauft, was sich nur verkaufen ließ. Während die Frauen beschäftigt waren, musste ich kleine Besorgungen erledigen. Als ich wieder einmal unterwegs war, verfolgte mich auf dem Rückweg ein russischer Soldat. Da ich mich im Ort auskannte, konnte ich ihm entkommen. Es war schrecklich.
Da Mutter ja Polnisch sprach, konnte sie sich frei bewegen, ohne als Deutsche aufzufallen. Wenn wir Kinder dabei waren, durften wir kein Wörtchen sprechen, was uns natürlich manchmal sehr schwer fiel. Dabei hätten die russischen Soldaten meine hübsche kleine Schwester mit ihren blonden Haaren und den blauen Augen gerne auf den Schoß genommen, gestreichelt und mit Süßigkeiten verwöhnt
Читать дальше