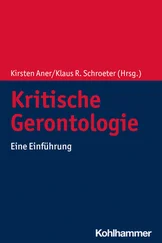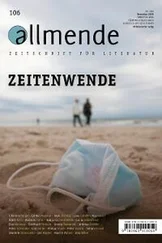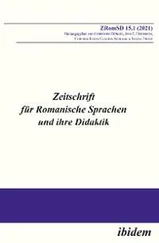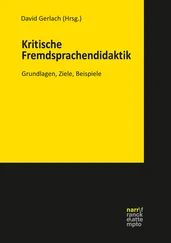Thomas Jung - Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 36/37
Здесь есть возможность читать онлайн «Thomas Jung - Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 36/37» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 36/37
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 36/37: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 36/37»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 36/37 — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 36/37», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Aus der Redaktion gibt es zu vermelden, dass Wolfgang Bocks Berufung auf eine Professur in Rio de Janeiro eine organisatorische Umstrukturierung mit sich gebracht hat: Er ist 2012 vom Herausgeberteam in die Redaktion gewechselt.
ABHANDLUNGEN
Andreas Greiert
»Weh spricht: vergeh«
Negative Dialektik und Biopolitik
Mit der Negativen Dialektik präsentiert Theodor W. Adorno einen Alternativentwurf zur »semantischen These« des deutschen Idealismus, nach der die Einheit des Begriffs mit der Einheit des Subjekts gleichzusetzen ist.1 Diese Einsicht ist in der Forschung unumstritten. Durchaus strittig erscheint hingegen, inwieweit und mit welcher Konsequenz Adorno eine tragfähige materialistische Gegenposition zum Idealismus vorgelegt hat.
Mit dieser Frage setzt die vorliegende Untersuchung an: Die vorgelegte Skizze von Adornos negativer Dialektik besitzt ihr erkenntnisleitendes Interesse darin, das materielle Moment am »Nichtidentischen« und am »Vorrang des Objekts« einmal so buchstäblich wie überhaupt nur möglich zu nehmen (Abschnitt I). Einen entsprechenden Anspruch hat Adorno selbst verkündet mit dem Eingeständnis, keine wie immer auch veränderte Philosophie könne »die Einzeldinge in die Texte kleben«2. Die Markierung dieser unüberschreitbaren Grenze als eines Defizits verdeutlicht nicht nur eine unumgängliche Beschränktheit der begrifflichen Erkenntnis. Vielmehr wird zugleich anstelle des Abstrakt-Semantischen das Dinghaft-Somatische zur eigentlichen Widerspruchsinstanz gegen die idealistische Identitätsbehauptung.
Bei dieser entschieden materialistischen Lesart rückt die negative Dialektik in eine überraschende thematische Nähe zum aktuellen Diskursraum der Biopolitik, in dem schließlich generell Einigkeit darüber besteht, den Menschen weniger als Vernunftwesen denn als leibliche Entität zu fassen (Abschnitt II). Zugleich existieren unterschiedliche und durchaus widersprüchliche Lesarten des Begriffs Biopolitik, die von einer kritisch intendierten Beschreibung bestehender Herrschaftspraktiken bis zu dem Anspruch auf einen emanzipatorischen Perspektivenwechsel reichen.3 Vor diesem Hintergrund provoziert eine Auseinandersetzung mit Adornos Akzentuierung des somatischen Elements in der Negativen Dialektik die Frage nach dem Verhältnis zu aktuellen Positionen im Projekt der Biopolitik. Diese Frage wird abschließend anhand von sowohl von Adorno als auch von Giorgio Agamben vorgelegten Skizzen zu einer neuen Ethik nach Auschwitz erörtert (Abschnitt III).
I.
Nach Auschwitz, so Adorno in der Negativen Dialektik , ist durch die geschichtliche Objektivität »die Konstruktion eines Sinns der Immanenz, der von affirmativ gesetzter Transzendenz ausstrahlt, zum Hohn« verurteilt (ND, 354). Die negative Dialektik impliziert somit nicht nur eine Konstellation von Immanenz und Transzendenz, die, ebenso denknotwendig wie undenkbar, auf eine ganz andere Verfassung der Welt verweist.4 Vielmehr wird das metaphysische Potential zugleich auch entwertet, nämlich, und das ist entscheidend, säkularisiert zum Projekt einer »Rettung des Nichtidentischen« in dem »Blick, der deutend am Phänomen mehr gewahrt, als es bloß ist, und einzig dadurch, was es ist« (ND, 38 f.). Wenn Adorno das »Eingedenken des Nichtidentischen« als »Scharnier negativer Dialektik« (ND, 24) bezeichnet, dann kommt in dieser Metonymie ein dezidiert anti-idealistischer und metaphysikkritischer Vorbehalt zum Ausdruck: »Der Begriff des Nichtidentischen dient als Platzhalter für den Rest, der in einem notwendigen Vorrang des Positiven nicht aufgeht und sich durch keine erkenntnistheoretische Aufklärung wegargumentieren lässt«5.
Dass das Nichtidentische notwendig aporetisch ist und bleiben muss, hat Adorno selbst schon offen eingeräumt, indem er bündig festhält, dass es als »Sache selbst« keineswegs Idee ist, sondern »Zugehängtes«, in dem unterzugehen die Wahrheit des Subjekts wäre (ND, 189 f.).6 Diese Aporie aber hat sich für Adorno in die Metaphysik selbst hinein verlängert; diese steht und fällt mit der Veränderbarkeit der Wirklichkeit: »Nur wenn, was ist, sich ändern läßt, ist das, was ist, nicht alles« (ND, 391). Mit ihrer programmatischen Amalgamierung geschichtsphilosophischer und erkenntnistheoretischer Motive verlässt die negative Dialektik die überlieferten Bahnen akademischer Philosophie und nimmt stattdessen die Spur von Nietzsches »radikaler Genealogie« auf.7 Adornos Methode eines »Lesen des Seienden als Text seines Werdens« (ND, 62) sieht alles Gegebene stets und ausnahmslos als Gewordenes an, das, so die Pointe, auch anders werden kann. Die Einsicht, dass alles Seiende »nicht einfach so und nicht anders ist, sondern unter Bedingungen wurde«, entkräftet den Bann des Fetischs von der »Irrevokabilität des Seienden« (ND, 62).
Adornos berühmte Metapher vom »Sturz der Metaphysik« verortet diese in den höchst banalen Niederungen geschichtsphilosophischer Spekulation: »Sie traut die Möglichkeit eines richtigen Bewußtseins auch von jenen letzten Dingen erst einer Zukunft ohne Lebensnot zu« (ND, 390). Auf die Frage nach der von Natur emanzipierten Gesellschaft kann gar nicht begrifflich geantwortet werden: »Zart wäre einzig das Gröbste: daß keiner mehr hungern soll«8. Im unwiderruflichen Prozess ihrer Säkularisierung hat die einst »reine metaphysische Erfahrung« sich an das geheftet, von dem sie als dem Unreinen und Materiellen ehedem weg wollte: »Sie hält sich negativ in jenem Ist das denn alles?, das am ehesten im vergeblichen Warten sich aktualisiert« (ND, 368).
Versagung und Verfall als Grundkonstanten körperlichen Daseins: Die Erkenntnis der Armseligkeit der physischen Existenz »zündet« ins oberste Interesse, ins »Was ist das und Wohin geht es« (ND, 359). Die im Materiellen schmerzlich präsente Gewissheit der Endlichkeit ist Ausgangspunkt für das metaphysische Fragen; sie weckt die Begehrlichkeit, über die bestehenden Widersprüche hinauszugehen zu einem ganz anderen Ganzen, das jedoch nicht begrifflich rein, als im idealen System sich verwirklichendes Absolutes vorgestellt werden darf. Eine Versöhnung der bestehenden Widersprüche im Denken weist Adorno schließlich kategorisch barsch zurück: »Unversöhnlich verwehrt die Idee von Versöhnung deren Affirmation im Begriff« (ND, 163). Entsprechend wird von Adorno die Aufgabe von Philosophie begriffen als aporetisches Unterfangen, mit den Mitteln des Denkens über das Denken hinauszugelangen: »An Philosophie ist es, das vom Gedanken Verschiedene zu denken, das allein ihn zum Gedanken macht, während sein Dämon ihm einredet, daß es nicht sein soll« (ND, 193).
Wenn Adorno sich also »im Augenblick ihres Sturzes« mit der Metaphysik solidarisch bekennt (ND, 400), dann gilt seine Solidarität fraglos dem Wahrheitsanspruch der Metaphysik, »ihrem alles Bestehende auf ein Absolutes hin transzendierenden Impuls«.9 Dieser Wahrheitsanspruch aber wird für Adorno gleichsam freigesetzt, und so auch erst fassbar, im Augenblick ihres Sturzes, in dem vor der hehren Frage nach den letzten Dingen unversehens ganz ungewohnt handfeste Gegenstände auftauchen: »Das Bedürfnis, Leiden beredt werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit« (ND, 29). Mit dieser so typisch apodiktischen Feststellung zerrt Adorno die Idee der Wahrheit grob aus dem Elfenbeinturm heraus und mutet ihr zu, sich im Dunstkreis eines schieren Materialismus zu bewähren.10
Diese Veränderung des Wahrheitsanspruchs hat Adorno in der Philosophischen Terminologie auf die grundlegende Einsicht zurückgeführt, »daß der Mensch als ein empfindendes, erlebendes, erkennendes Wesen selber auch wesentlich Leib ist«11, und zur Kompensation eines so notorischen wie systematischen Reflexionsdefizits aller klassisch idealistischen Metaphysik auf ein »Aroma des Materialismus« verwiesen, das den Erfahrungsraum zwischen der »Organlust« und dem Tod prägt.12 Zugleich postuliert Adorno aber auch, dass dem Materialismus schon von sich aus ein ursprünglicher metaphysischer Erfahrungsgehalt zukommt. In spezifisch materialistischer Perspektive ist schließlich die Beziehung zum Leib identisch mit der Beziehung zum Tod »als dem Niedrigen, Widerlichen und Naturverfallenen, dem wir alle bis heute unterworfen sind«13.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 36/37»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 36/37» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Zeitschrift für kritische Theorie / Zeitschrift für kritische Theorie, Heft 36/37» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.