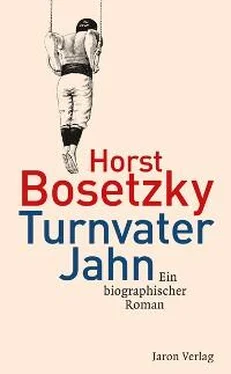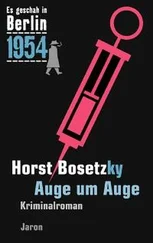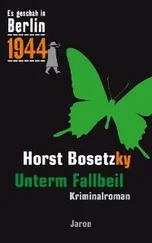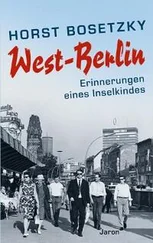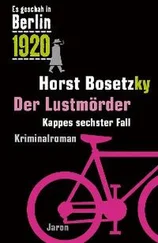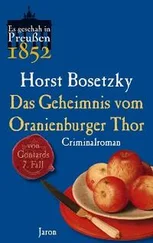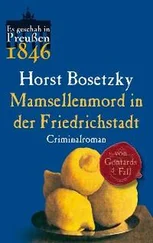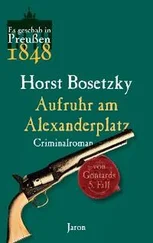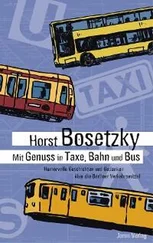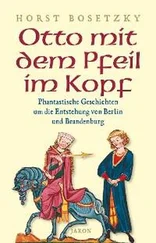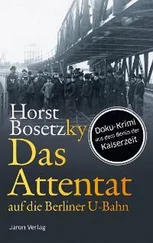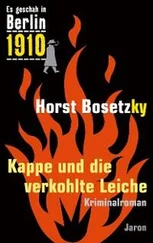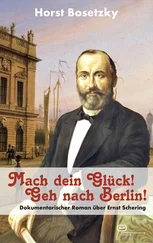Der Theologe Friedrich Gedike, den Alexander Friedrich Jahn in Berlin getroffen hatte, verfolgte diese Entwicklung mit großer Sorge. Mit Woellner stand er auf Kriegsfuß. Der hatte schon einmal behauptet, Gedike lehre die jungen Leute, sie sollten nicht an Jesus Christus glauben und nicht zum heiligen Abendmahl gehen, denn er selbst tue das auch nicht. Das war 1785 gewesen. Der Alte Fritz hatte Woellner daraufhin »einen hinterlistigen und intriganten Pfaffen« genannt und es abgelehnt, ihn in den Adelsstand zu erheben. Nun aber war Woellner unter Friedrich Wilhelm II. aufgestiegen zum Staats- und Justizminister und Chef des geistlichen Departements. Gedike, der 1793 die Leitung des Gymnasiums zum Grauen Kloster übernommen hatte, musste sich vor ihm in Acht nehmen, wollte er die Schule nicht noch weiter gefährden. Gerade eben hatte Friedrich Wilhelm II. erklärt, Gedike gehöre zu den Aufklärern, die er nicht mehr lange dulden werde.
»Wohin soll das nur führen?«, fragte Gedike seufzend, als er mit einem seiner Vertrauten, dem Deutschlehrer Franz Steinhauser, am 27. September 1794 beisammensaß.
»Der König hat etwas gegen die Aufklärer«, sagte Steinhauser. »Die Allgemeine Deutsche Bibliothek von Friedrich Nicolai darf nicht mehr erscheinen.« Dann schmunzelte er. »Ich behandle mit meinen Schülern gerade den Streit zwischen Goethe und Nicolai. Ihr wisst sicher, dass Goethe unserem wackeren Nicolai dessen polemische Kritik an seinem Werther nie verziehen hat. Aber kennt Ihr auch Goethes böses Gedicht, mit dem er sich an Nicolai rächen wollte?«
Als Gedike verneinte, reichte ihm Steinhauser das Blatt hinüber, auf dem das Gedicht fein säuberlich geschrieben stand.
Nicolai auf Werthers Grabe
Ein junger Mensch, ich weiß nicht wie,
starb einst an der Hypochondrie
und ward denn auch begraben.
Da kam ein schöner Geist herbei,
der hatte seinen Stuhlgang frei,
wie ihn so Leute haben.
Der setzt sich nieder auf das Grab
und legt ein reinlich Häuflein ab,
schaut mit Behagen seinen Dreck,
geht wohl eratmet wieder weg,
und spricht zu sich bedächtiglich:
»Der arme Mensch, er dauert mich
wie hat er sich verdorben!
Hätt er geschissen so wie ich,
Er wäre nicht gestorben!«
Gedike reichte dem Lehrer das Blatt zurück und seufzte. »Lieber Steinhauser, verwendet das Gedicht lieber nicht im Unterricht. Ich sehe schon Woellners Büttel angelaufen kommen, um Sie wegen der unangebrachten Sprache zu sanktionieren.«
Weiter kam Gedike nicht, denn ein Secretär klopfte an die Tür des Rektorats und meldete, dass ein gewisser Friedrich Ludwig Jahn aus Lanz erschienen sei, um sich einer Aufnahmeprüfung zu unterziehen.
»Ach, das habe ich fast vergessen!« Gedike fasste sich an den Kopf. »Er soll gleich hereinkommen.«
»Die Klassen sind eigentlich schon voll«, sagte Steinhauser.
»Sicher, aber der Vater ist ein guter Bekannter von mir und außerdem auch Pfarrer. Doch bleibt nur hier und macht Euch auch ein Bild von seinem Sohn.«
Als Friedrich Ludwig Jahn vor ihm stand, war Gedike, wie damals der Rektor Wolterstorff vom Salzwedeler Gymnasium, nicht gerade erbaut. Er bevorzugte Jungen, die gertenschlank waren und denen man ansah, dass sie ihren Aristoteles kannten und selbst Gedichte schrieben. Dieser Sechzehnjährige aber war ein grober Klotz, der eher in eine Schmiede passte denn auf ein Gymnasium.
»Nun denn, fangen wir mit dem Lateinischen an. Was heißt Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur ?«
»Also … concordia ist die Eintracht und discordia die Zwietracht.«
»Und was ist mit denen?«
Jahn bekam es nicht gleich zusammen. »Ja, also, dilabuntur kommt von … von … na, dilanbuntere .«
»Dieses Wort gibt es meines Wissen im Lateinischen nicht«, stellte Gedike fest.
Steinhauser war zu sehr Menschenfreund, um nicht helfend einzugreifen. »Denkt doch mal an dī-lābor, di-lābī , was auseinanderfallen oder zerfallen bedeutet.«
Mit dieser Hilfestellung schaffte Jahn nach einigen weiteren Irrwegen schließlich die richtige Übersetzung: »Durch Eintracht wächst Kleines, durch Zwietracht zerfällt das Größte.«
Das war nicht eben glänzend, und auch in der Mathematik blieb Jahn unter dem Niveau, das im Grauen Kloster als Mindestmaß galt. Gedike fragte sich, ob es bei der kargen Besoldung eines preußischen Pfarrers wirklich lohnte, für einen Sohn von diesem Format monatlich drei Thaler Schulgeld aufzubringen und dafür auf vieles zu verzichten. Nun, in Lanz hatte man sich die Sache sicher reiflich überlegt, und nur ein richtiger Schulabschluss öffnete einem jungen Menschen die Tür zu den preußischen Universitäten und damit das Thor zu einem erfolgreichen Leben.
»Nun, Jahn, vielleicht seid Ihr in der Theologie so firm, dass wir hinsichtlich Eurer offensichtlichen Mängel in den eben abgeprüften Fächer etwas nachsichtiger sein können.« Gedike überlegte einen Augenblick, um eine geeignete Frage zu finden. »Wie lautet die erste der 95 Thesen von Martin Luther?«
» Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte: ›Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen‹, wollte er, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. «
»Das kam ja überaus prompt«, lobte Gedike. »Wo finden wir in der Heiligen Schrift Passagen zum Thema Buße?«
Auch bei dieser Frage brauchte der junge Jahn nicht lange zu überlegen. »Ich denke zuerst an Matthäus, Kapitel 3, Vers 2: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen . Oder auch an Markus, Kapitel 1, Vers 15: Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Dann fällt mir noch die Apostelgeschichte ein, Kapitel 2, Vers 38: Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. «
»Das ist phänomenal!«, rief Gedike begeistert. »Nun prüfen wir noch etwas Geschichte.« Damit wandte er sich an Steinhauser, dass der mit der Prüfung fortfahre.
»Wir wollen voraussetzen, lieber Friedrich, dass Ihr alle Kriege kennt, die Preußen geführt hat. Was aber hat unser österreichisches Brudervolk vor kurzem bewegt?«
Jahn zögerte keine Sekunde mit der richtigen Antwort. »Das war der Russisch-Österreichische Türkenkrieg von 1787 bis 1792.«
»Richtig. Und wer waren die Heerführer?«
»Grigori Alexandrowitsch Potjomkin bei den Russen, Sultan Abülhamid I. bei den Türken und Feldmarschall Laudon bei den Österreichern.«
»Sehr schön! Wer hat das Osmanische Reich schließlich gerettet?«
Jahn schmunzelte. »Unser König Friedrich Wilhelm II., indem er mit dem Sultan ein Bündnis geschlossen hat.«
Gedike kam das zwar ein bisschen verkürzt vor, dennoch zollte er dem Jungen die gebührende Anerkennung. »Nun, lieber Jahn, damit habt Ihr die Aufnahmeprüfung summa summarum bestanden und dürft Euch von nun an voller Stolz als Unterprimaner unserer Einrichtung betrachten.«
Friedrich Ludwig Jahn verfügte schon sehr früh über ein großes Selbstvertrauen. Er war nicht nur in hohem Maße von sich selbst überzeugt, sondern hatte darüber hinaus das Gefühl, am Ende einen Platz in den Geschichtsbüchern einzunehmen. Im Brief des Paulus an die Epheser stand: Er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen möget, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid . Jahn glaubte fest daran, dass er vom Herrn dazu auserwählt war, Höheres zu schaffen. Deshalb ging er im Stillen davon aus, so vermessen und irrwitzig das für einen Menschen seiner Intelligenz auch war, dass man ihn in Berlin jubelnd empfangen werde, zumindest in den Hallen seines neuen Gymnasiums. Doch natürlich dachte niemand auch nur im Traum an eine solche Begrüßung. Ein bisschen empörte Jahn das schon. Als er seinem Freund Philipp Pulvermacher im ersten Brief vom grünen Strand der Spree andeutungsweise davon Kenntnis gab, antwortete der: Was willst Du eigentlich? Der erste Monat des Jahres ist doch schon nach Dir benannt worden, der Jahnuar.
Читать дальше