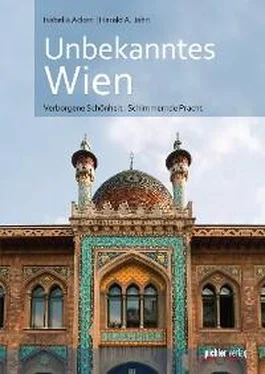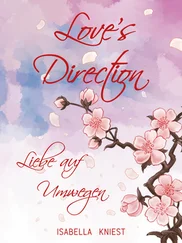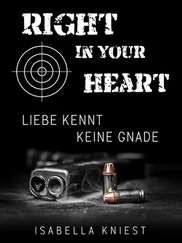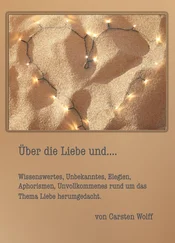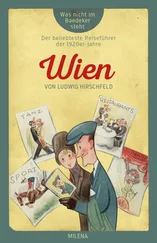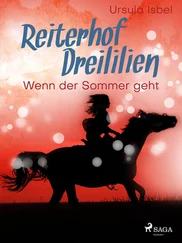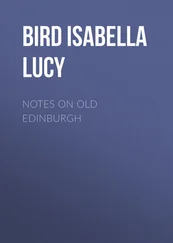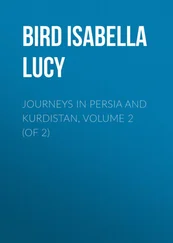Grundsätzlich wurden die Stadtmauern, soweit man das rekonstruieren kann, zuerst aus Erde angehäuft und dann mit Mauerwerk ummantelt. Im Bereich des Mauerzugs gab es immer wieder vorspringende Basteien, von denen aus der Feind von zwei Seiten unter Feuer genommen werden konnte. Zwischen den Basteien wurden – den Mauern vorgelagert – so genannte Ravelins errichtet, einzeln stehende Befestigungswerke, deren Kanonen das Vorfeld nach vielen Seiten bestreichen konnten. Die Höhe der Mauern lässt sich in etwa mit acht bis zehn Metern schätzen, zum Teil mögen sie höher gewesen sein, je nachdem, wie tief der Graben jeweils freigelegt wurde. Denn in Friedenszeiten war der rund 20 Meter breite Stadtgraben nichts anderes als eine große Mülldeponie. Bei den Restaurierungsarbeiten für das Palais Coburg wurden Reste der Dominikanerbastei gefunden, die bis zwölf Meter unter das heutige Straßenniveau reichen.
Den nächsten großen Schrecken erlebten die Wiener mit der Zweiten Türkenbelagerung 1683, als die Stadt tatsächlich beinahe erobert worden wäre. Denn den osmanischen Minen und Sprengsätzen waren die Stadtmauern nicht gewachsen. Lediglich das herannahende Entsatzheer konnte die Katastrophe im letzten Moment verhindern. Als Wien 1805 und 1809 von den Franzosen eingenommen wurde, spielten die Festungsmauern schon längst keine Rolle mehr, denn sie hätten den Kanonen ohnehin nicht standhalten können. 1809 ließ Napoleon eher zur Demonstration seiner Macht, denn zur Beseitigung einer gefürchteten Verteidigungsanlage die Burgbastei sprengen – die Befestigungen hatten endgültig ausgedient. Nun war es nur mehr eine Frage der Zeit bis zu ihrer totalen Schleifung, die mit kaiserlicher Order von 1857 eingeleitet wurde. Anstelle der Stadtmauern entstand der Prachtboulevard der Wiener Ringstraße.

1010 Wien, Coburgbastei, Dominikanerbastei, Mölkerbastei (Straßenbahn1, 2 und D) Stubenbastei (U3)

8. Die „Fenstergucker“
von St. Stephan:
KANZEL UND ORGELFUSS
Bis vor wenigen Jahren ging man in den kunsthistorischen Beschreibungen des Domes von St. Stephan davon aus, dass die beiden „Fenstergucker“, jene männlichen, sich aus dem Fenster lehnenden Figuren an der Kanzel und am Orgelfuß, von der Hand eines einzigen Meisters stammen, nämlich vom Dombaumeister Anton Pilgram, der sich beim Porträt am Orgelfuß mit seinem Monogramm MAP und der Jahreszahl 1513 verewigte.

Die stilistischen Unterschiede zum Fenstergucker an der Kanzel erklärte man mit unterschiedlichen Schaffensperioden des Meisters: Der Kanzelfuß und damit die ganze Kanzel seien ein Frühwerk Pilgrams, da das Porträt noch sehr formalistisch erscheint, während jenes am Orgelfuß deutlich realistischer ausgefallen sei.
Über lange Zeiträume wurde Ähnlichkeit mit Identität gleichgesetzt, und damit wurde die Kanzel in ihrer unglaublich filigranen räumlichen Konstruktion auch Meister Pilgram zugeschrieben.
Tatsache ist, dass sich wesentliche stilistische Divergenzen aber nicht nur mit verschiedenen Schaffensperioden erklären lassen. Mittlerweile lässt sich der Schalldeckel der Kanzel – er wird nun als Deckel des Taufbeckens verwendet – ziemlich eindeutig mit 1480 datieren, ein Jahr, für das es keinerlei Beweise für einen Aufenthalt Pilgrams in Wien gibt.
Für den Skulpturentyp des Fensterguckers existiert eine Reihe von Vorbildern in Frankreich. Überdies ist erwiesen, dass Niclaes Gerhaert van Leyden, der die Straßburger Kanzel, aber auch den Sarkophag Porträt des Meister Pilgram Friedrichs III. im Stephansdom schuf, sich bis 1487 in Wien und Wiener Neustadt aufgehalten hatte. Die Verwandtschaft der anderen Kanzelfiguren mit den Werken van Leydens ist stupend. Vor allem die fast entmaterialisierte Bearbeitung des Steins verweist eher auf ihn oder zumindest auf seine Schule.

Typischer Fenstergucker, neutrales Porträt
1010 Wien, Stephansplatz (U1 und U3, Autobus 1, 2 und 3)
Daher erscheint es zum gegenwärtigen Zeitpunkt als unbestritten, dass die beiden Fenstergucker in St. Stephan das Werk verschiedener Meister sind. Ob van Leyden oder einer seiner Schüler die Kanzel schuf, wird noch weiter zu erforschen sein.
9. Satire auf den Protestantismus:
„WO DIE KUH AM BRETT SPIELT“
UND ANDERE WIENER HAUSZEICHEN
Das seltsame Hauszeichen am Haus Bäckerstraße 12 erzählt nicht von einem erfinderischen Tierbändiger, der einer Kuh das Brettspiel beibrachte. Das Fresko, das um die Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden sein mag, macht sich vielmehr über die Protestanten lustig. Es entstand zu einer Zeit, als in Österreich und vor allem in Wien schon längst die Gegenreformation gesiegt hatte. Andere Erklärungsversuche interpretieren das Fresko als einen bösen Scherz für einen Hausherrn.
Im Vorgängerbau des jetzigen Hauses wohnte zu Ende des 14. Jahrhunderts der Wiener Bürgermeister Konrad Vorlauf. Er erlangte traurige Berühmtheit, da er sich als Wiener Bürgermeister im habsburgischen Erbstreit zwischen Herzog Leopold IV. und Herzog Ernst wie alle begüterten Bürger der Stadt auf die Seite von Herzog Ernst gestellt hatte. Nachdem sich die beiden Kontrahenten geeinigt hatten, wurde Vorlauf auf Forderung der anderen Partei verhaftet und quasi als Sündenbock am 11. Juli 1408 hingerichtet. Er war damals etwa 73 Jahre alt. Bis zur Zerstörung 1945 gab es im Wiener Stephansdom eine Tafel zu Füßen des Friedrich-Grabes, die an ihn erinnerte.
Hausbezeichnungen wie „Wo der Wolf den Gänsen predigt“ – der Wolf steht für die „bösen“ Protestanten und die Gänse für die „guten“ Katholiken – (Wallnerstraße 11; das Original des Hauszeichens befindet sich heute im Wien Museum) und „Wo die Böck’ aneinander stoßen“ (Postgasse 1) beziehen sich ebenfalls auf den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten. Im Haus Wallnerstraße soll es sogar zu geheimen protestantischen Zusammenkünften gekommen sein. Ein späterer Hausbesitzer wollte mit dieser Bezeichnung eine Warnung an die Bürger richten. „Wo der Teufel mit der Bognerin rauft“ ist ein Hausschild (Bognergasse 3), das an eine alte Wiener Sage anknüpft. Anspielend auf eine Rauferei zwischen dem Teufel und einem alten Weib, trug das Haus die Inschrift: „Pestilenz und Not ein Übel ist, Krieg ein arger Zeitvertreib. Schlimmer als des Teufels Tück und List, Gott behüt uns †††, ist ein böses Weib.“ 1904 wurde dieses Haus abgetragen.
Auch das Hausschild „Wo die Jungfer zum Fenster hinausschaut“ thematisiert eine Wiener Sage von einer Jungfer während der Pestzeit. Als sie vom Fenster aus die Leiche ihres Liebsten im durch Hochwasser angeschwollenen Alserbach vorbeitreiben sah, stürzte sie sich in die Fluten.
Andere recht skurrile Hausbezeichnungen sind uns mit „Wo der Hahn den Hühnern predigt“ oder „Wo der Hahn sich im Spiegel schaut“ überliefert und lassen sich nicht mehr erklären.
Читать дальше