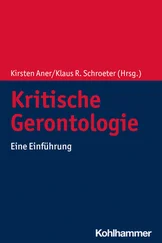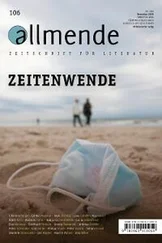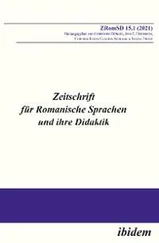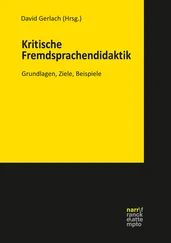Gerhard Schweppenhäuser
Zur Kritik der Medienethik*
Was ist Medienethik? Die Verwendung des Begriffs »Ethik« ist mehrdeutig. Häufig ist von »Medienethik« die Rede, wenn es um die »Moral« der Massenmedien geht: also darum, was dort als üblich, sittlich geboten und erwünscht gilt – oder als illegitim, verachtenswert und empörend. Dies entspricht der Rede von der »Wirtschaftsethik«, verstanden als Arbeitsmoral – als Werte und Handlungsnormen, die man in der ökonomischen Welt für rechtschaffen und erstrebenswert hält. Zugleich bezeichnet der Begriff »Medienethik« aber auch die wissenschaftliche Untersuchung der Moral, die dem Betrieb der Massenmedien inhärent ist. Die äquivoke Verwendung von »Medienethik« entspricht der Unterscheidung zwischen »Moral« und »Ethik«. »Moral« ist ein Sammelbegriff für die Überzeugungen der Einzelnen, was gut oder gerechtfertigt ist, sowie für die Sitten in einer Gemeinschaft.1 Unter »Ethik« wird hingegen die »Reflexionstheorie der Moral«2 verstanden. Allerdings nicht, wie Luhmann meinte, im Sinne einer Theorie, die rein deskriptiv verfährt, ihren Gegenstand bloß wie ein Spiegel reflektiert und keine begründete normativ-kritische Stellung dazu einnehmen kann. Luhmanns Definition ist falsch, weil sie unterstellt, dass sinnvollerweise nur deskriptive Ethiken formuliert werden könnten und weil sie die Möglichkeit normativer Moralphilosophie leugnet. Arbeitet man jedoch mit einem anderen Begriff der Reflexion als Luhmann, nämlich mit einem philosophischen, kann »Reflexionstheorie der Moral« als Synonym für »Moralphilosophie« verwendet werden. Als Terminus ist »Ethik« dann gleichbedeutend mit »Moralphilosophie«.
Philosophische Ethik fragt, wie Moralprinzipien begründet werden, ob die Begründungen stichhaltig sind und welche moralischen Überzeugungen gerechtfertigt werden können. Wenn es um »Medienethik« im Sinne der Berufs- und Standesethiken geht, wie zum Beispiel im Ethik-Kodex des Deutschen Presserates,3 sollte man deshalb lieber von »Medienmoral« sprechen. Wenn im Folgenden von »Medienethik« die Rede ist, sind moralphilosophische Analysen von Wertorientierungen und Handlungsnormen bei der Produktion, Distribution und Rezeption von Massenmedien gemeint. Dies folgt dem Sprachgebrauch in Philosophie und Medienwissenschaft. Unter Medienethik versteht man dort die »wissenschaftliche Beschäftigung mit der vorhandenen Medienmoral und Kommunikationskultur«4. Einen ausgearbeiteten philosophischen Begriff des Mediums findet man in den Entwürfen der Medienethik in der Regel allerdings nicht. Ein »Medium« ist dort sozusagen die Einzahl von »Medien«, und dieses Wort wiederum wird im Sinne der journalistischen Rede von »den Massenmedien« verwendet (Presse, Radio, Fernsehen und Internet). Als deskriptive Ethik fragt Medienethik, was in der dort gängigen »Medienpraxis« als moralisch gerechtfertigt gilt. Als normative Ethik bewertet sie die Medienpraxis und fragt, welche Werte und Normen hier vernünftigerweise gelten sollten.
Mir geht es nicht um die Darstellung aller Positionen, die gegenwärtig in der Medienethik vertreten werden, sondern um den Versuch, ihre Grundlagen zu skizzieren. Für diese ist es zunächst von elementarer Bedeutung, ob es ihren Vertretern zu zeigen gelingt, dass es überhaupt einer eigenen, bereichsspezifischen Teil-Ethik für mediale Produktion, Distribution, Konsumtion und Applikation bedarf. Werden die hier relevanten moralischen Kriterien nicht bereits in zureichendem Maße von der allgemeinen Ethik reflektiert? Hier scheiden sich die Geister. Im medienethischen Diskurs wird immer wieder auf die Besonderheiten hingewiesen, welche die neuen Kommunikations- und Kulturtechniken mit sich bringen, und zwar unter dem Aspekt der speziellen Verantwortlichkeit, die es in der Herstellung und im Umgang mit Medienprodukten zu beachten gelte.
Eike Bohlken hat vor mehr als zehn Jahren argumentiert, dass die Begründung einer Teilethik für den Medienbereich auf der Basis des Verantwortungsbegriffs nur im Hinblick auf die Medienmacher erfolgen könne, und nicht im Hinblick auf die Nutzer.5 Zwei sehr verbreitete, intuitiv einleuchtend wirkende Argumentationsweisen seien gerade nicht dazu tauglich, eine Verantwortungsethik des Mediengebrauchs zu begründen: der Verweis auf die Informationspflicht der Bürger und die moralische Bewertung medialer Inhalte sowie des Umgangs mit ihnen. Denn die Pflicht, sich angesichts von Handlungsentscheidungen, die stets auch andere und häufig das Gemeinwesen betreffen, sachkundig zu machen, um verantwortungsvoll handeln zu können, lasse sich aus allgemeinen ethischen Grundsätzen ableiten. Und ebenso reichten allgemeine Moralprinzipien völlig aus, um beispielsweise den Konsum menschenverachtender Medieninhalte und -formen negativ zu bewerten und mit guten Gründen zurückzuweisen. Nach Bohlken ist einzig und allein im Hinblick auf die Medienproduzenten von einer spezifischen Verantwortung auszugehen, deren Art und Umfang im Rahmen einer Medienethik auszuarbeiten sei. Denn im Verhältnis von Medienproduzenten und Medienrezipienten fehle jene strukturelle Symmetrie, welche für »die basale Anerkennung des anderen als moralisches Subjekt bzw. als Verantwortungsinstanz«6 vorauszusetzen sei. Wenn moralische Verantwortung verpflichtenden Charakter habe, dann deshalb, weil sie aus der wechselseitigen Verwiesenheit von sozialen Akteuren aufeinander erwachse. Diese allgemeinethische Norm müsse aufgrund der »Asymmetrie der zumeist einwegigen massenmedialen Kommunikation«7 durch bereichsspezifische Anwendungsnormen ergänzt werden. Dann lasse sich postulieren, dass Medienmacher dazu verpflichtet sind, Mediennutzer als moralische Subjekte anzuerkennen.
So weit, so gut – aber muss es nicht auch Begründungen geben, die über den formalen Verweis auf die Unerlässlichkeit wechselseitiger Anerkennung hinausgehen und der Begründung einer Medienethik als Verantwortungsethik inhaltliches Gewicht geben? Im Folgenden werde ich mich, um den entsprechenden Begründungsansatz nachzuzeichnen, hauptsächlich auf den Medienethiker Rüdiger Funiok beziehen. Funiok geht es weniger um ein eigenes medienethisches Argumentationsmodell, als um einen konsensfähigen Extrakt aus der Debatte der letzten zwei Jahrzehnte;8 seine Schriften genießen Anerkennung unter Fachleuten, und seine Arbeit wird auch in der Medienöffentlichkeit wahrgenommen.
Maßstab ist für Funiok und andere »das Gelingen medienvermittelter demokratischer Kommunikation«9, durch die Öffentlichkeit entsteht: eine Sphäre für die Selbstvergewisserung mündiger Menschen über ihre Lebensformen und -inhalte. »In den modernen Massendemokratien«, resümiert Funiok die Sozialgeschichte der Medien,
»ist der Willensbildungsprozess auf die Vermittlung von (repräsentativen) Meinungskundgaben in Zeitungen, später auch im Radio und Fernsehen angewiesen. Die Herstellung von Öffentlichkeit für Themen von allgemeinem Interesse und die kommunikative Legitimierung von politischer Autorität stellen seither eine grundlegende Funktion der Medien dar.«10
Medien haben demnach den »gesellschaftliche[n] Auftrag […] demokratische Meinungsbildung zu ermöglichen und zu fördern«11, damit die gegenwärtige »Mediengesellschaft« eine »demokratische Wissensgesellschaft bleiben oder werden«12 könne. Adressaten der Medienethik sind Personen und Institutionen, die Medien produzieren und verbreiten. Postuliert wird ein Bewusstsein der Verpflichtung zum verantwortlichen Handeln, das Funiok (mit Bernhard Debatin) eine »innere Steuerungsressource«13 nennt. Wenn diese, oder, in traditioneller Terminologie: wenn das Pflichtbewusstsein fehlt, ist das Rechtssystem mit seinen Verboten zuständig. Aber nicht allein das Konzept der Pflicht schaffe Handlungslegitimation, sondern vor allem das der Verantwortung.14 Grundlage der Bewertung ist in der Medienethik also nicht mehr die individualethische Frage, ob »aus Pflicht« gehandelt worden sei, sondern die sozialethische, ob sich jemand für sein Handeln im Hinblick auf legitime Ansprüche anderer verantworten könne. Jeder Medienakteur solle »über die Güte seines Handelns verantwortlich entscheiden«15, heißt es im Handbuch Medienethik aus dem Jahre 2010.
Читать дальше