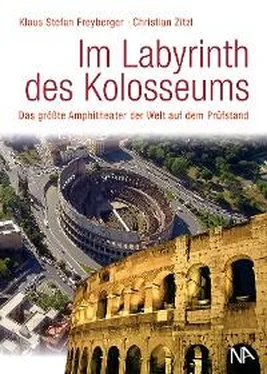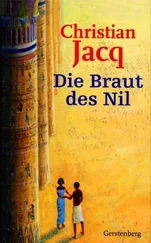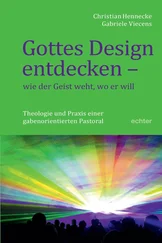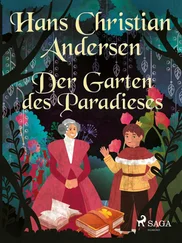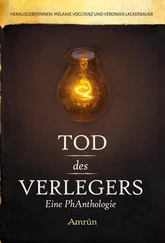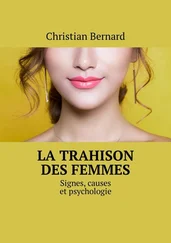Im Jahr 2000 wurden sechs Bohrungen im Bereich der Arenaeinbauten ausgeführt. 27Vier von ihnen stellten die Fundamenttiefe der Tuffmauern mit 3,25 m fest. Die Bohrkerne wiesen unterschiedliche Ausführungen der Fundamente nach, die auf das unregelmäßige Gelände zurückgeführt werden. Da die Tuffblöcke der Mauern nicht direkt auf den Streifenfundamenten, sondern auf der Grundplatte der Masicciata ruhen, besaß das Untergeschoss der Arena demnach eine Bodenoberfläche, die zunächst ohne Mauern genutzt wurde. Die Blöcke des opus quadratum aus Monteverde-Tuff erreichten Maße bis zu 2,40 × 1,30 × 0,90 m.
Zwischen den Befunden der spätrepublikanischen Zeit und der vermuteten flavischen Bauzeit des Kolosseums besteht eine chronologische Lücke. Daraus folgt zwingend, dass nach den beschriebenen Befunden das Kolosseum spätestens in die spätrepublikanische Zeit und zwar in den Zeitraum vom Ende des 2. Jhs. bis in die 1. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr. datiert werden muss.
Nach der Planung und Ausführung der Fundamente während der Herrschaft des Kaisers Vespasian wurden im Jahr 80 n. Chr. die Einweihungsspiele von dessen Sohn Titus veranlasst. Das aufgehende Mauerwerk stammt angeblich aus der Regierungszeit des Titus und Domitian. 28Angesichts der für ein Bauwerk dieser Dimension auffallend kurzen Zeitspanne vom Entwurf bis zur Einweihung (ca. zehn Jahre) und der chronologischen Lücke im Fundmaterial überrascht vor allem die Tatsache, dass aus dem vermeintlich flavischen Bauniveau keine flavischen Funde erwähnt wurden.
Die Holzabdeckungen in der Arena
In den Untergeschossen der Arena wurden Reste einer Bauphase vorgefunden, die noch vor der Errichtung der Tuffmauern in Benutzung stand. Ein System von Quadern aus Travertin mit quadratischen Pfostenlöchern trug senkrechte und darüber waagrechte Holzbalken, die in die Umfassungsmauer der Arena einbanden. Zueinander halten sie einen Abstand von 1,50 m ein. 29Man nimmt an, dass diese Konstruktion für eine der Einweihungsfeiern 79 oder 80 n. Chr. entstand. Mit ihr war es möglich, die noch unbebaute Fläche des Untergeschosses für Naumachien (Seeschlachten) zu nutzen. Diese sind von Martial (Liber spectaculorum 24–26, 30) und Sueton (Domitian 4) schriftlich bezeugt. Die durch große Nischen und Steinkonsolen belebte Umfassungsmauer hätte bei diesen Veranstaltungen eine Art Bühnenhintergrund geboten.
Für die Abdeckung der Arena in vespasianischer Zeit ersetzte man die einzelnen Pfostenhalter aus Travertin durch Ost-West orientierte Mauerzüge aus Tuff, die das Untergeschoss in die 2 – 4 m breiten Korridore A bis H unterteilten. Diese Mauern waren 0,90 m tief und 6,30 m hoch. Man geht davon aus, dass sie zu schwach bemessen waren und nachträglich verstärkt werden mussten. Die Holzabdeckung der Arena ist anhand der Spuren auf den Oberlagern der erhaltenen Tuffmauern rekonstruierbar (Phase A). 30In den schwalbenschwanzförmigen Aussparungen auf den Mauerkronen lagen kurze Querhölzer, die parallel zu den Mauern verlaufende Pfetten unterstützten. Diese trugen Querbalken, die den betreffenden Korridor überspannten und auf denen die Bohlen des Bretterbodens auflagen.
Allen Phasenbeschreibungen am Kolosseum ist anzumerken, dass die chronologische Prämisse eines Neubaus auf der grünen Wiese bzw. im See in flavischer Zeit Probleme aufwirft. Die Bauabfolge muss auf einen sehr kurzen Zeitraum zusammengedrängt werden. Der Entwurf wird der Regierungszeit des Kaisers Vespasian zugeschrieben. Die Mittel für den Bau kamen aus der Beute des Jüdischen Kriegs und standen demnach wohl erst ab 71 n. Chr. zur Verfügung. Das Gebäude wurde aber laut der Überlieferung von Sueton (Domitian 4,1) erst während der Herrschaft des Kaisers Domitian fertiggestellt, der bereits wieder die hölzerne Arenaabdeckung für die Einweihungsfeier durch Titus mit Mauereinbauten erneuern musste. 31Es erscheint unsinnig, dass eine höchstens zehn Jahre alte Struktur schon wieder restauriert werden musste, da dieselben Tuffmauern noch heute bestehen. Zu der 24 Jahre währenden Herrschaft der flavischen Dynastie gehören demnach sowohl die Abdeckung der Arena mit den Blöcken aus Travertin als auch die Pfostenständer und der auf den Tuffmauern aufliegende Arenaboden der Phase A. Warum sollte man extra für die beiden Einweihungsfeiern 79 und 80 n. Chr. einen eigenen Arenaboden errichten, um bald danach Mauerzüge einzuziehen und eine völlig anders konstruierte Arenaabdeckung auszuführen?
Mit diesen Maßnahmen wurde die Nutzung für Naumachien aufgegeben. Es fragt sich, warum dem Spielbetrieb diese Einschränkung auferlegt wurde. Vielleicht hatte Nero, der für Naumachien mit Krokodilen schwärmte, an seinem „stagnum“ bauliche Veränderungen vornehmen lassen, welche die Weiterführung dieser Darbietungen erschwerten. Das zur Flutung der Arena nötige Wasser könnte in der Domus Aurea anderen Zwecken zugeführt worden sein. Die domitianische Datierung der Tuffmauern beruht auf der Annahme, dass nach der Errichtung der Naumachia Vaticana diese Funktion ausgelagert wurde. Ebenso erscheint es eigenartig, dass zwei Eröffnungsfeiern stattfanden, obwohl sich das Bauwerk angeblich erst in einem rudimentären Zustand befand. 32Es kann sein, dass es sich dabei nur um propagandistische Spektakel handelte, aber wahrscheinlicher ist die Annahme, dass die Strukturen eines älteren Amphitheaters weiter benutzt wurden.
14
Panella 1990, 62–70 Abb. 1, 2, 4–6, 27–34.
15
Ebd., 67–70 Abb. 34.
16
Panella 1996, 166 Abb. 154.
17
Panella 1990, 67 Abb. 1, 16, 28; Panella 1996, Abb 6, 7.
18
Panella 1996, 166 Abb. 154.
19
Medri 1996, 166 Abb. 152, 154.
20
Rea et alii 2002, 343 Abb. 1, 2.
21
Rea et alii 2000, 313–317, 337 f. Abb. 2, 4, 16, 30, 38–40.
22
Vorbehaltlich der Richtigkeit der Datierungen. Die Datierungsgrundlagen erscheinen größtenteils wenig tragfähig und lassen frühere Entstehungszeitpunkte möglich erscheinen.
23
Ebd., 316, 330 Abb. 37 US 628: Massicciata, 0,50 m stark.
24
Ebd., 322 Abb. 16 (US 2731), 324.
25
Ebd., 319 f. Abb. 11 (US 630).
26
Rea et alii 2002, 346–349 Abb. 4, 6, 7. Die Zeichnung Abb. 6 besitzt weder eine Angabe zur Lage des Aufschlusses noch zu den Himmelsrichtungen. Dasselbe gilt für Abb. 7, auf der unter den vielen Strukturen der obere Fundamentring nicht sicher zu erkennen ist.
27
Ebd., 354–361 Abb. 10, 12.
28
Beste 1998, 118.
29
Beste 2000, 115–118.
30
Beste 2011, 262–269 Abb. 2, 3.
31
Rea et alii 2002, 352 f.
32
Ebd., 346 noch ohne äußere Tragkonstruktion (?).

Das Kolosseum im Vergleich mit Bauten in Latium aus dem 1. Jh. v. Chr.
Die Ansichtsseite der ersten drei Geschosse des Kolosseums (vgl. Abb. 3– 7) ist in der Verwendung des Steinmaterials, der Gliederung der Fassade, der Mauertechnik, der Bearbeitung der Steinblöcke und der Gestaltung einzelner Bauglieder vergleichbar mit spätrepublikanischen und frühaugusteischen Bauwerken, wobei sich für Gebäude aus flavischer Zeit keine entsprechenden Beispiele finden. Die keilsteinförmigen Blöcke der Bögen zwischen den Pfeilern mit vorgelagerten Halbsäulen sind charakteristisch für spätrepublikanische Repräsentationsbauten, wofür das im Jahr 78 v. Chr. restaurierte Tabularium in Rom 33und das Heiligtum des Herkules Viktor in Tivoli anschauliche Zeugnisse bieten. 34Die enormen Dimensionen der auf der Schauseite geglätteten Quaderblöcke der Pfeiler kommen in entsprechender Ausführung am Marcellus-Theater in Rom vor, das aber erst 14 v. Chr. von Augustus eingeweiht wurde (Abb. 12). 35Im Unterschied zu diesem Gebäude, dessen Keilsteine in den Bögen getrennt von den horizontal geschichteten Quaderblöcken bearbeitet wurden, sind die Keilsteine am Kolosseum durch eine horizontale und vertikale Fuge mit den Steinblöcken der aufgehenden Wand eng verzahnt (vgl. Abb. 4). Dieselbe Art der Verzahnung von Keilsteinen mit Quaderblöcken findet sich an der Fassade des frühaugusteischen Amphitheaters in Augusta Praetoria (Aosta). 36Die eigens gearbeiteten Kämpfergesimse in Form einer profilierten Platte aus Travertin sind eine charakteristische Eigenheit spätrepublikanischer Architektur, die am Kolosseum (vgl. Abb. 3, 4), am Marcellus-Theater (Abb. 13) und an den tabernae auf der Südseite der Basilica Aemilia feststellbar sind, wobei die drei genannten Beispiele in der Formgebung der Profile leicht variieren. 37Das Kolosseum und das Marcellus-Theater in Rom gleichen sich auch zum Teil im Aufbau der Fassadengliederung. Beide Bauten haben, von unten nach oben gezählt, eine dorische, ionische und korinthische Ordnung. Größere Übereinstimmungen bestehen in den dorischen Kapitellen, die als gemeinsame Elemente einen schmalen Abakus und einen flachen Echinus haben (vgl. Abb. 4). Unter Letzterem folgen an den Kapitellen des Marcellus-Theaters drei wulstförmige Ringe (Abb. 14), während die Produkte am Kolosseum an entsprechender Stelle ein nicht verziertes Profil in Form eines konkaven Kymas aufweisen (vgl. Abb. 4). In diesem Punkt überliefern die Werkstücke des erstgenannten Gebäudes den Aufbau dorischer Kapitelle getreuer als die wenig jüngeren Bauglieder am Kolosseum. Beide Bauwerke unterscheiden sich in den ionischen Kapitellen voneinander. Während die Artefakte am Kolosseum ein kleineres Format besitzen und zum Teil gleich späthellenistischen Bossenkapitellen in der Grundform gearbeitet sind (vgl. Abb. 5), zeichnen sich die entsprechenden Bauglieder am Marcellus-Theater durch groß proportionierte Voluten mit tief geformtem Kanal und einem hohen Eierstab aus (Abb. 15). Die korinthischen Kapitelle der 3. Ordnung am Kolosseum sind für die Datierung nicht verwertbar, da sie im frühen 3. Jh. n. Chr. durch den Neubau der von einem Blitz beschädigten Attika in Mitleidenschaft gezogen wurden und erneuert werden mussten (vgl. Abb. 6). Der Dekor am Kolosseum wirkt verhaltener wie die schlichte Gestaltung der ionischen Gebälke über den Kapitellen der drei Ordnungen bezeugt. Im Unterschied dazu ist die erste Ordnung am Marcellus-Theater von einem dorischen Gebälk bekrönt (vgl. Abb. 12, 14), das nicht die verhaltene Eleganz der Gebälke am Kolosseum erreicht. Behält ersterer Bau die dorische Ordnung strikt bei, deren Halbsäulen keine Basen und Plinthen besitzen (vgl. Abb. 12), so zeugt die dorisierende Ordnung am Kolosseum von einem kompositen Aufbau (vgl. Abb. 7). Der traditionellere Aufbau des Fassadendekors und die einfachere Bautechnik identifizieren das Marcellus-Theater als das ältere der beiden Bauwerke. Wahrscheinlich wurde der Theaterbau zumindest teilweise schon in voraugusteischer Zeit ausgeführt, wofür sich die in Travertin hergestellten korinthischen Kapitelle der dritten Ordnung als zeitliche Indizien anführen lassen (Abb. 16). Auf der anderen Seite legen die vielen Übereinstimmungen in der Bautechnik und der Formgebung zwischen dem Marcellus-Theater und den ersten drei Geschossen des Amphitheaters die Vermutung nahe, dass diese Stockwerke des vermeintlich flavischen Kolosseums entschieden älter sind und bei der flavischen restitutio in den Gesamtbau integriert wurden.
Читать дальше