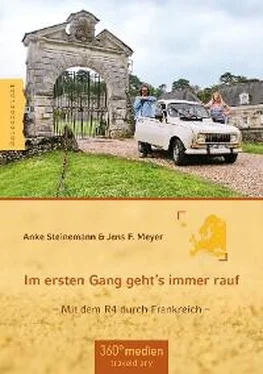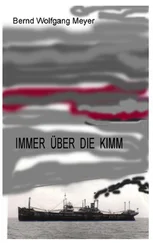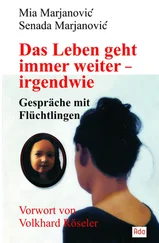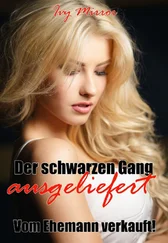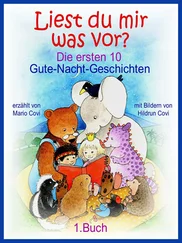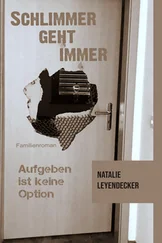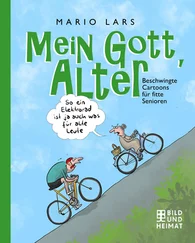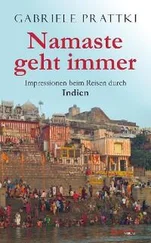Charmantes Städtchen: Bar-sur-Aube
Radfahrer winken und machen große Augen. Einen R4 ohne Rost haben sie in Frankreich seit Jahrzehnten nicht gesehen. „Une bonne voiture“, rufen sie. Und eines, das so sehr in diese Landschaft passt. Man möchte in ihre Tiefe greifen, sie sich seinem Innersten einverleiben, sie spüren wie den Nachklang von Schampus und Burgunderwein. Man möchte einen Vorrat an Eindrücken, Düften und Bildern in Flaschen und Fässern abfüllen, um an tristen Wintertagen davon zu kosten. Vor uns nichts als Freiheit und ein zufrieden sirrender Motor, über uns der Himmel. Und dann steht da plötzlich ein riesengroßes Kreuz, weithin sichtbar in dieser Landschaft aus Rebstöcken, Feldern und Wald. Es ist die Gedenkstätte für General Charles de Gaulle, erster Präsident der Fünften Republik Frankreichs, und die Erinnerung an die französische Exilregierung während des Zweiten Weltkriegs. Das Lothringische Kreuz in Überüberübergröße, ein fast 45 Meter hohes Monstrum, das ohne Fundamente 950 Tonnen wiegt, weil es aus 36.525 Pflastersteinen und 1638 rosa Granitplatten gebaut wurde. Solange der Wind nicht stärker als 150 Kilometer pro Stunde bläst, wird es sicher nicht umfallen, so haben es jedenfalls die Architekten damals versprochen. Man könnte folglich, gemessen an der Höchstgeschwindigkeit eines Renault 4, mit Vollgas daran vorbeifahren, und dieses Lothringische Kreuz würde standhaft seinen Dienst als Bewahrer der Erinnerung tun, ohne auch nur ins leiseste Zittern zu geraten. Das ist aber ohnehin graue Theorie, denn in Colombey-les-Deux-Églises ist ein solches Tempo gar nicht möglich. Es würde den armen Maiglöckchen, die hübsch drapiert aus dem Aschenbecher hervorlugen, auch nicht guttun. Übrigens ein Aschenbecher ohne Zigarettenanzünder, was wunderlich ist. Man würde annehmen, es sei nie ein französisches Auto ohne Heißmacher für Gauloises und Gitanes gebaut worden, denn immerhin gilt Frankreich bis heute als letztes Tabakparadies der westlichen Welt. In der Tat hatte es ab Werk aber in keinem der über 8,1 Millionen gebauten Exemplare jemals einen Zigarettenanzünder gegeben.
Lignol-le-Château hat einen putzigen Namen, die edlen Kupferlaternen an der Ortsdurchfahrt lassen auf gut situierte Champagnerhersteller schließen. D, D, D – es wird zum Lieblingsbuchstaben. Immer tiefer gelangen wir über manch magere Piste in die Seele dieses Landes. Die „Route du Champagne“ schlürft der kleine Renault, wie wir es mit dem Schaumwein tun: mit Genuss. Die D47 ist eine schmale Straße, auf der wenig Verkehr unterwegs ist, die D619 serviert schönste Ausblicke, tief in das Land hinein, die D3 ist sogar so wenig befahren, dass hier rechts vor links gilt! Es wäre aber doch anzunehmen, dass ein R4 grundsätzlich Vorfahrt hat …? „Es sei denn, er trifft auf einen 2CV.“ In der Bar du Château in Vendeuvre-sur-Barse lässt ein Handwerker, der gerade Mittagspause hat, keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Ente in Frankreich noch beliebter ist. Enten haben eine bessere Lobby. Während sie oft fein restauriert als Liebhaberobjekt gefahren werden, vermag der R4 sein Image als verlässliches Arbeitstier selbst ein Vierteljahrhundert nach Auslieferung des allerletzten „Bye-bye“-Modells irgendwie nicht loszuwerden. Ein Makel ist das nicht; ohne Zweifel ist „La Quatrelle“, zu jeder Zeit das praktischere Fahrzeug der beiden Klassiker gewesen. Sie sind aber in der Tat so grundverschieden, dass jeder Vergleich ein kleines Verbrechen ist. Hier die Ente, der Citroën mit dem leicht fröschelnden Motörchen, da der Renault, dessen 34-PS-Aggregat den Klang einer sirrenden Nähmaschine hat. Müsste dem Handwerker gefallen. Aber er stichelt. Wir sind gekränkt.
„Monsieur, die Ente hat weniger PS und ist langsamer!“
„Stimmt“, sagt er.
„Und sie ist unpraktischer. Der Renault hat einen größeren Kofferraum und bessere Sitze“, legen wir nach.
„Stimmt“, sagt er.
„Außerdem ist die Quatrelle nicht so reparaturanfällig und günstiger im Unterhalt. Und sie schwankt nicht wie ein Schiff auf offener See.“
„Stimmt“, sagt er.
„Gut, dann ist die Sache doch klar. Der R4 ist das bessere Auto!“
„Non, jamais!“
Dem Mann ist nicht zu helfen. Wir lenken das Gespräch in eine andere Richtung und fragen, warum das Schloss auf der Straßenseite gegenüber leer steht. Immerhin sei es doch ein „Monument historique“ und infolgedessen von beachtlichem Wert. Noch dazu sehe es hübsch aus und sei von einem ansprechenden Park umgeben. Der Enten-Fan rät uns, zur Gemeindeverwaltung zu gehen. „Es steht zum Verkauf. Kaufen Sie es doch“, sagt er und grinst mit Bierschaumschnäuzer.
„Danke, Monsieur. Das würden wir unbedingt tun wollen, aber die Quatrelle war teuer. Fürs Château wird das Geld wohl nicht mehr reichen.“
Nun ist er doch sprachlos. Wir trinken aus und fahren fort an diesem Maiglöckchentag, der in Tonnerre enden wird; Tonnerre, die Stadt der magischen Quelle.
Die Schlange in der Tiefe
Die reizende Stadt Tonnerre, am Flüsschen Armançon gelegen und nicht weit vom Canal de Bourgogne entfernt, hat ungefähr 4500 Einwohner. Glaubt man der Sage, wohnt eine Schlange in der geheimnisvollen Quelle Fosse Dionne, die unterhalb der Kirche Saint-Pierre ihre Wasser unaufhörlich in einen eindrucksvollen Waschplatz aus dem 18. Jahrhundert speit. Wissenschaftler, Taucher, Gelehrte – keiner ist dem geradezu unheiligen Quell so richtig auf die Schliche, geschweige denn auf den Grund gekommen. La Fosse Dionne ist nicht das einzige Wahrzeichen dieses quirligen Ortes im Département Yonne, aber auf jeden Fall das sprudelndste. (Info: france-voyage.com)

(Be)rauschend: die Quelle La Fosse Dionne in Tonnerre
Es sind die Dachziegel aus eisenhaltigem Ton und der weiße Stein aus Tonnerre, der die müden Sonnenstrahlen zur Dämmerung aufsaugt und sie auf eigenartige Weise reflektiert, die Tonnerre an wolkenlosen Tagen so unglaublich rosa erscheinen lässt. Tonnerre ist das, was Reisende lieben, wenn sie es entdecken. Denn da ist eine Quelle, eine ewig rauschende, und die Quatrelle hat ihren Weg zu dieser Quelle gefunden. „La Fosse Dionne“ ist ein Mysterium. Niemand weiß, wo ihr Ursprung ist, und manch Suchender hat sein Leben dafür gegeben. Legenden ranken sich um das rätselhafte Becken, unter anderem ist von der Schlange Basilic die Rede, die in diesen Wassern wohnen soll. Die Schlange dürfte beim Tauchgang das geringste Problem sein, eher ist es die Tiefe: zunächst 28 Meter, dann 360 Meter in den Berg hinein, und weitere 68 Meter hinabfallend. Ein Labyrinth der Unterwelt. Wir warten einen Moment lang, aber die Schlange zeigt sich nicht. Vielleicht ist sie zu Besuch bei Mutter Nessie in Schottlands Highlands. Etwas enttäuscht sind wir schon.
Eine Galerie fürs innere Auge
Als bezauberndes Beispiel der französischen Renaissance gilt das von einem Wassergraben und weitläufigen Park umgebene Château de Tanlay. Mitte des 16. Jahrhunderts war es erbaut worden. Große Augen machen Besucher in einem Eckturm mit Deckengemälde der Schule von Fontainebleau, das berühmte Persönlichkeiten aus jener Zeit als Gottheiten darstellt. Noch erstaunlicher ist allerdings die Grande Galerie, weil hier die Trompe-l’œil-Malerei meisterhaft umgesetzt worden ist. Wände und Decke sind illusionistisch perfekt inszeniert. Dreidimensionalität wird vorgetäuscht, wo es sie gar nicht gibt. Was ist wahr, was nicht? Die Grande Galerie wirkt wie eine Parallelwelt. Sehr beeindruckend. Und zwar echt! (Info: chateaudetanlay.fr)
Читать дальше