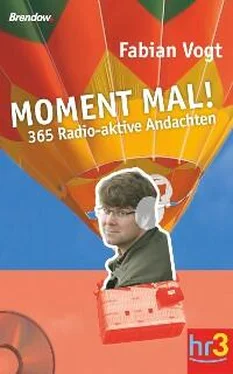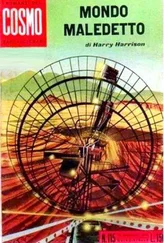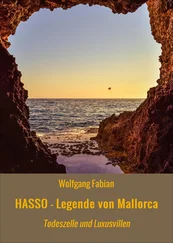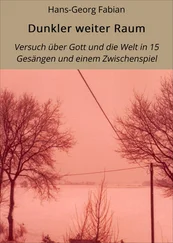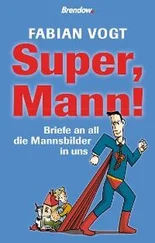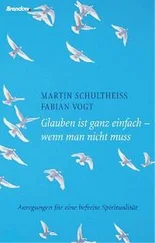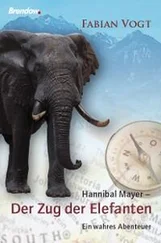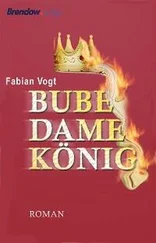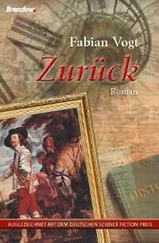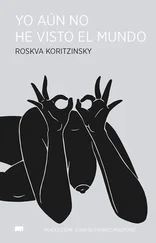Tja, welche Wirtschaftsform ist denn jetzt die beste? Schwere Frage. Aber eines ist klar: Gut ist auf jeden Fall die Staatsform, der es gelingt, sich vor Dogmatismus zu hüten. Die nicht ein endgültiges System, sondern die Menschen an erste Stelle setzt. Die also immer neu und offen fragt, ob ihre Ideale den Menschen weiterhin guttun. Jesus hat das übrigens ganz liebevoll vorgemacht. Er sagte einmal: »Die Gebote sind für den Menschen da. Nicht die Menschen für die Gebote.« Das gilt bis heute.
FEBRUAR
25
Die Ärzte rieten dem jungen Mann: »Nutzen Sie ihre letzten Monate gut. Sie haben einen unheilbaren Hirntumor und werden demnächst sterben.«
Oh! Nach dieser schockierenden Diagnose kündigte der Verzweifelte sofort seine Stellung als Lehrer im asiatischen Brunei und kehrte nach England zurück. Er wollte unbedingt in der ihm verbleibenden Zeit seiner Frau etwas Persönliches hinterlassen. Also fing er an, intensiv zu schreiben. Und siehe da, er veröffentlichte in den folgenden – übrigens: ziemlich gesunden – Jahren mehr als 50 Bücher. Anthony Burgess. Der Autor von »A Clockwork Orange« und vielen anderen Bestsellern. Einer, der seine Schriftsteller-Karriere zu Recht als Geschenk empfand.
Nun gehört Anthony Burgess auch zu den Autoren des 20. Jahrhunderts, die aus ihrem christlichen Glauben keinen Hehl gemacht haben und denen es wichtig war, Religion und Kirche in ihren Werken offen anzusprechen. Natürlich auch kritisch – aber Burgess hatte immer den Blick eines Menschen, der weiß, was es bedeutet, eine persönliche Auferstehung zu erleben.
Vielleicht hat er auch deshalb so nette Sätze gesagt wie: »Lache, und die Welt lacht mit dir. Schnarche, und du schläfst allein.« Heute hätte er Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch.
FEBRUAR
26
»To browse« heißt »stöbern«, »sich umsehen«, »schmökern«. Und wer im Internet stöbern will, der braucht einen Browser. Mit dem kann man die Inhalte des weltweiten Datennetzes darstellen. Auf seinem Bildschirm.
Ich dachte fast, ich werd nicht mehr, als ich jetzt gelesen habe, dass der erste Webbrowser überhaupt erst 1991 der Öffentlichkeit präsentiert wurde, nach der Wende. Ja, am 26. Februar 1991. Das Ding hieß damals wie das Netz, »World Wide Web«, und wurde von einem Mann namens Tim Berners-Lee erfunden. Seither können wir Seiten aus dem Internet auf unserem Computer öffnen. Sprich: Durch den Browser bekommen wir Zugriff.
Anfangs war ich verblüfft, dass das erst 1991 passiert ist, ich brauche schließlich inzwischen jeden Tag einen Browser. Doch dann wurde mir klar, dass die Idee eigentlich viel älter ist. Ja, es geht beim Browsen doch darum, etwas darzustellen, auf das man sonst keinen Zugriff hätte. Und als Theologe fällt mir da sofort ein Vergleich ein.
Gott ist auch etwas, das man nicht einfach so lesen und verstehen kann. Man braucht dazu einen Browser. Sozusagen einen Gott-Browser. Und den hat Gott selbst online, oder besser, »onearth« gestellt. Nämlich seinen Sohn. Jesus zeigt den Menschen, wie Gott ist. Damit die endlich Zugriff bekommen.
O. k., ein gewagtes Bild. Aber jetzt versteh auch ich als Pfarrer endlich, was ein Browser ist.
FEBRUAR
27
2009 ging es noch knapp aus. Ganz knapp. Fast wären die Studienanfängerinnen da schon in der Mehrheit gewesen. Aber es hat dann doch nicht ganz gereicht. Nun, 2010 wird es wahrscheinlich so weit sein: Mehr Frauen als Männer schreiben sich an Hochschulen ein und beginnen in Deutschland ein Studium.
Für diesen einzigartigen Erfolg der Gleichberechtigung brauchten die Frauen genau … na? 110 Jahre. Ja, denn im Jahr 1900 durften sich Ende Februar zum allerersten Mal Frauen in Deutschland immatrikulieren. Und zwar im liberalen Baden. Preußen brauchte noch bis 1908. Allerdings war da der Siegeszug der Akademikerinnen schon nicht mehr aufzuhalten.
Heute scheint es fast absurd, dass die europäische Gesellschaft den Frauen jahrhundertelang das Recht auf Bildung vorenthalten hat – vor allem die Kirchen haben sich bei diesem Thema wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Unverständlicherweise übrigens.
Jesus sagt doch den berühmten Satz: »Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid.« Alle. Also Männer und Frauen. Nur weiß kaum einer, wie der Satz weitergeht. Da steht nämlich wörtlich: »Kommt alle und lernt. Lernt von mir.« Jesus selber lädt also Frauen zum Lernen ein. Das müssen die Theologen vergangener Tage irgendwie überlesen haben. Schade. Und was für ein Glück, dass Frauen diese Texte heute selbst studieren können.
FEBRUAR
28
Es war im Jahr 380. Da erklärte der römische Kaiser Flavius Theodosius am 28. Februar das Christentum zur allein gültigen und verbindlichen Staatsreligion. Mmh.
Nun kann man ja vom christlichen Glauben denken, was man will: Mit seinem Edikt »Cunctos Populos« begründete Theodosius letztlich das christliche Abendland. Und dass wir heute eine Gesellschaft haben, die auf christlichen Werten wie Menschenwürde, Freiheit und Nächstenliebe aufbaut, ist mehr als erfreulich.
Trotzdem gibt es viele Leute, die fragen: War dieser Schritt von Theodosius wirklich klug? Also: War es richtig, das Gedankengut dieser bislang verfolgten Glaubensgemeinschaft der Christen zum offiziellen Pflichtprogramm zu machen? Vorher hatten die Menschen ja die freie Wahl, ob sie Christinnen und Christen werden wollten; jetzt war es plötzlich so etwas wie ein Gebot.
Die Gefahr dabei ist ziemlich klar: Wenn etwas, das man aus Begeisterung, Leidenschaft und Überzeugung gemacht hat, plötzlich zur Pflicht, zur Gewohnheit und zum Ritual wird, dann geht das fast immer schief. Insofern wundert es auch nicht, dass ein verstaatlichtes Christentum so manche Macken hat.
Vielleicht ist es ein richtiger Segen, dass Menschen im 21. Jahrhundert das Geschenk des Glaubens wieder aus freier Entscheidung annehmen können. Und vielleicht tut das auch der Kirche gut.
MÄRZ
1
»Alle anders – Alle gleich.« Das war ein starkes Motto für die »Internationalen Wochen gegen Rassismus«, die kürzlich stattfanden. »Alle anders – Alle gleich!« Jeder Mensch ist ein Individuum, vor allem aber ist er ein Mensch. Ganz gleich, welche Hautfarbe, Religion, Kultur oder Erziehung er hat.
Nur wer das kapiert, ist auch in der Lage, etwas gegen die vielen kleinen und großen Formen von Rassismus zu unternehmen, die man in Deutschland täglich beobachten kann. »Hey, der Typ da, das ist nicht in erster Linie ein Norweger, ein Türke, ein Araber oder ein Afrikaner. Das ist ein Mensch.« Rassismus fängt nämlich genau da an, wo jemand das Gefühl hat, ein anderer sei irgendwie ein bisschen weniger Mensch.
»Alle anders – Alle gleich.« Nur: Woher stammt eigentlich der kluge Gedanke, dass alle gleich sind? Na, das ist einer der zentralen Inhalte des christlichen Glaubens! Und dabei geht es gar nicht um »Gleichmacherei«, sondern um eine echte Aufwertung des Menschen: Weil Gott uns geschaffen hat, sagt die Bibel, sind wir alle gleich, und zwar gleich wertvoll und gleichermaßen gewollt und geliebt.
Wer in jedem Menschen ein von Gott geliebtes Geschöpf sieht, kann den anderen gar nicht verachten. Insofern ist der Glaube auch eine gute Basis, um Rassismus zu überwinden. In der Geschichte der Kirche hat das leider nicht immer geklappt, aber Jesus hat zumindest vorgemacht, dass sich die Welt verändert, wenn man auch den merkwürdigsten Gestalten mit Liebe und Achtung begegnet. »Alle anders – Alle gleich.«
MÄRZ
2
Читать дальше