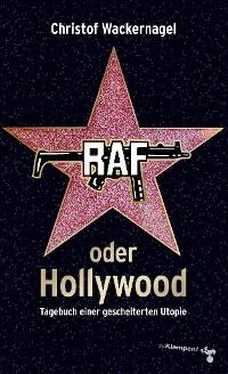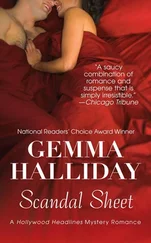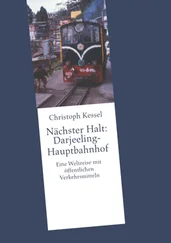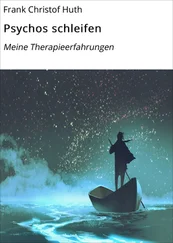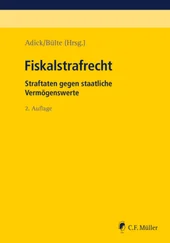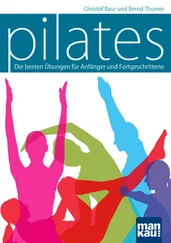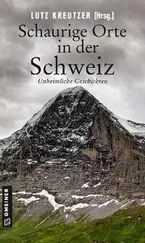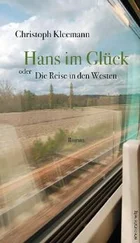Sabine zog vorsichtig die Tür zu, damit Sonnemann und seine Jünger unser Kichern nicht hören konnten.
Unser neuer Religionslehrer verkörperte das Gegenteil dessen, was ich bisher als Religionslehrer kennengelernt hatte: Er war nicht dünn, sondern dick, er war nicht schwarz, sondern bunt gekleidet, er war nicht ernst und gefasst vergeistigt über den Wolken schwebend, sondern handfest, humorvoll und lebenslustig.
Eine Diskussion darüber, dass Gott ein Trugbild war, ließ er allerdings nicht aufkommen: »Gott macht das Leben lebenswert«, verkündete er fröhlich, »er gibt uns die Freude und den Spaß!« Ich fand, dass er es sich damit etwas zu einfach machte, schließlich gab es genügend Menschen, denen das Leben aus guten Gründen überhaupt keinen Spaß machte, aber es war mir zu anstrengend, das zu diskutieren – er war wie eine Gummiwand, zwar weich und lustig wie auf dem Spielplatz früher, aber undurchdringlich.
Als er freilich in einer Stunde mal wieder damit anfing, dass die Werte »Gerechtigkeit«, »Mitmenschlichkeit« und »Liebe zur Kreatur als solcher« von Gott unabänderlich gesetzt seien, platzte mir der Kragen: »Warum sehen wir dann nirgends etwas davon?«, fragte ich. »Die Ungerechtigkeit auf der Erde wird doch eher immer größer als kleiner! Wenn alle Menschen Nutznießer der Schätze der Erde sind: Warum gibt es dann den Unterschied zwischen Arm und Reich?«
Er lächelte verschmitzt. »Gute Frage!«, lobte er mich. »Damit kommen wir nämlich zum Kern der Sache!«
Da war sie wieder, die Gummiwand.
»Das zu verwirklichen«, fuhr er fröhlich fort, »ist doch nicht Sache Gottes, sondern« – und nun kam die einstudierte Kunstpause, die er immer einlegte, bevor etwas Bedeutendes kam – »unsere Sache!«
Er lehnte sich zurück und wartete die Wirkung dieser – wie er wohl meinte – überraschenden Erklärung ab.
»Das ist es doch«, erläuterte er, »was das Leben so reich und vielfältig, so erfüllend macht: Wir haben eine Aufgabe!« Er strahlte uns an: »Das ist doch der Sinn des Lebens, nach dem alle suchen, die Gott noch nicht erkannt haben« – er wurde richtig gemütlich feurig – »dass wir immer und überall dafür kämpfen müssen, dass Gerechtigkeit tatsächlich und endlich für alle Wirklichkeit wird!«
»Und wie geht das Kämpfen?«, fragte ich.
»Bei uns selbst müssen wir anfangen«, antwortete er wie aus der Pistole geschossen, bevor irgendeine weitere Frage aufkam, »bei uns und in unserem unmittelbaren Umfeld, mehr geht sowieso nicht, und, das ist das Schwerste, daran besteht kein Zweifel, wir müssen Geduld haben, Geduld, Geduld und wieder Geduld.« Er holte kurz Luft und setzte sofort wieder zum Sprechen an, bevor ich meine nächste Frage loswerden konnte: »Das ist es doch, wofür wir Gott so unendlich dankbar sein dürfen: dass wir gar nicht nachzudenken brauchen, was unsere Arbeit hier auf Erden ist, sondern jederzeit und überall wissen, was wir zu tun haben: den Willen Gottes in die Tat umzusetzen und Gerechtigkeit unter den Menschen endlich – da geb ich dir recht, Wackernagel – lebendige Tatsache werden zu lassen.«
Damit erübrigte sich meine nächste Frage, nämlich, was denn die hungernden Kinder in China davon hätten, wenn ich hier in Deutschland, wo jeder Bettler im Vergleich zu ihnen reich war, in meinem Umkreis für etwas mehr Gerechtigkeit sorgte oder, wie man es uns als Kindern immer gesagt hatte, meinen Teller aufaß, weil sie nichts auf dem Teller hatten:
»… gar nicht nachzudenken brauchen!« – darum ging es bei dem Glauben.
Denn wenn man nachdachte, fiel man in das tiefe schwarze Loch.
Einer der Freunde meiner Alten war Leiter des »Theater der Jugend« in Schwabing. Er hieß Wolfgang Jobst, hatte lange graue Haare und trug stets eine speckige Lederweste. »Du kannst doch bestimmt gut spielen«, sprach er mich eines Tages an, als ich von er Schule kam und er mit meiner Mutter im Garten saß, »bei der Mutter!«
Ich zuckte mit den Achseln. Sabine wollte brennend Schauspielerin werden – ich auf keinen Fall. »Immer das Gleiche«, antwortete ich.
»Ich brauch noch einen Jungen in deinem Alter für mein neues Stück«, kam er daraufhin direkt zur Sache, »hast du keine Lust? Kannst Geld verdienen!«
Letzteres klang interessant. Ich wollte unbedingt ein Schlagzeug haben und mit Fips, Ebby und einem Verehrer von Sabine, der schon studierte, eine Band gründen – der Name stand schon fest: »the sad classics«. Auch welche Stücke wir nachspielen sollten, wusste ich genau, vor allem »Cadillac« von den Renegades, weil Julia das so liebte. Den Anfang des Stückes konnte ich schon auf der Tischplatte trommeln und hatte ihn Julia vorgespielt – daraufhin hatte sie quirlig gelacht, wie ich es so liebte an ihr, und ich war glücklich gewesen. Aber die Alten rückten das Geld nicht heraus.
Und so ging ich nach der Schule nur ein paar Straßen weiter ins »Theater der Jugend« am Hohenzollernplatz, aß in der Kantine Würstchen und Kartoffelsalat oder Nudeln, die ich von den Spesen, die ich bekam, selbst bezahlen konnte, hatte dann jeden Tag Probe in meiner Rolle als »Fuchs«, machte nebenher meine Hausaufgaben und kam erst abends nach Hause, was sehr spannend war und die Sache allein schon wert machte.
Vor allem aber konnte ich, als ich gegen Ende der Probenzeit mein erstes Geld bekam, endlich das Schlagzeug kaufen und sofort mit den Bandproben bei uns im Keller beginnen. Da ich das Ganze initiiert hatte, schlug ich auch immer vor, was und wie und wann wir spielten und es schien den anderen gerade recht zu sein. Schnell hatten wir genügend Stücke zusammen, um auf der nächsten Party meiner Eltern auftreten zu können.
Als wir bei einer der letzten Proben vor der Premiere in unseren Kostümen mitten im Bühnenbild saßen und eine kleine Pause machten, erzählte ich den anderen davon und wollte vor allem vor Jobst angeben.
»Ich bin jetzt Bandleader!«, prahlte ich, sprang auf und trommelte den Anfang von »Cadillac« auf einer Stuhllehne, »wir können schon ganz viele Stücke, auch von den Troggs, von Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich und sogar Jimi Hendrix!«
Jobst, der eben noch mit uns gescherzt und gelacht hatte, wurde plötzlich sehr ernst.
»Setz dich mal wieder hin«, sagte er, beugte sich auf seinem Stuhl vor und sah mich intensiv an.
»Was heißt ›leader‹ auf Deutsch?«, fragte er.
»Führer«, übersetzte ich eher unwillig.
»Dieses Wort«, fuhr Jobst an alle gewandt, fort, »kann man in Deutschland nicht mehr aussprechen.«
Ich wurde rot vor Scham.
»Der so Bezeichnete – ihr wisst alle, von wem ich rede – hat so viel Unheil über die Welt gebracht, dass wir ein für alle Mal unsere Lehren daraus ziehen müssen«. Nun lächelte er wieder und sah mich an: »Du hast es zwar nicht so gemeint und auf Englisch merkt man es nicht so – aber es ist das Gleiche: Das hast du gar nicht nötig, Christof!«
Ich hätte mich ohrfeigen können – das hätte mir nicht passieren dürfen! Ich hatte doch auch nur mit der Musik angeben wollen, nicht mit der Rolle, die ich dabei spielte. Am liebsten wäre ich weggelaufen.
»Menschen«, schloss Jobst, »brauchen keine Führer. Das unterscheidet uns von Tieren – Tiere können nicht anders, als dem Leithammel zu folgen. Das ist das Erste, was wir an Hitler, der furchtbarsten Form von Führer, zu lernen haben.«
Er stand auf, die Probe ging weiter.
»Aber, weil sehr viele Menschen eben doch noch verführbar sind«, sagte er wie nebenbei, »dürfen wir nicht das geringste bisschen zulassen, das wieder in diese Richtung führt.«
Ich sagte den Rest der Probe nichts mehr. Zuhause ging ich sofort in mein Zimmer. Die Wunde brannte tief.
Klaus Hehl war zwar ein Freund meiner Schwester Sabine, aber wir befreundeten uns schnell auch unabhängig von ihr. Er war Abiturient und hatte eine sehr tiefe Stimme, die ihn älter wirken ließ, als er war, und etwas Ehrfurcht, fast Autorität Gebietendes an sich hatte. Er lebte ganz in unserer Nähe in einem kleinen, mit Büchern überladenen Zimmer, in dem ich ihn eine Zeitlang so oft es ging besuchte und mit ihm über die Bücher, von deren Inhalt er mir entweder nur berichtete oder die er mir zum Lesen mitgab, diskutierte.
Читать дальше