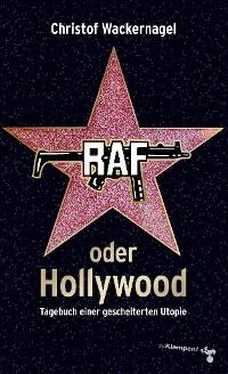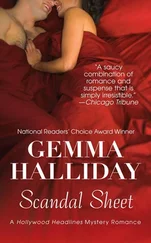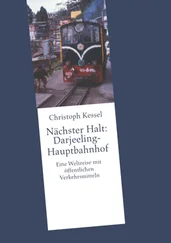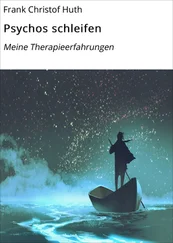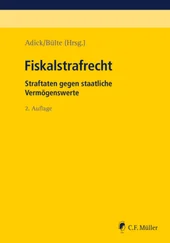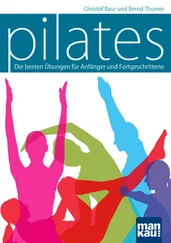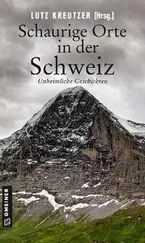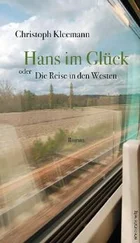Für die Freiheit […] kann und soll man das Leben wagen. 86
Cervantes
… für eine Welt der Gerechtigkeit. 87
John F. Kennedy
Und ich »junger Bürger«, für den dieses Buch herausgegeben worden war, verstand: Es war nicht nur mein Recht, sondern meine sittliche Pflicht, für Freiheit und eine Welt der Gerechtigkeit zu kämpfen und eventuell sogar mein Leben zu wagen.
Heinz Höfl war Journalist bei der »Süddeutschen Zeitung« und regelmäßiger Gast in unserem Hause. Ich mochte ihn gerne, denn er sprach mit mir wie mit einem Erwachsenen. Er war zehn Jahre jünger als die Alten, hatte aber den Krieg noch als Kind mitbekommen und wog immer ab, wenn wir zum Beispiel über politische Dinge sprachen: »Natürlich ist Adenauer eine Witzfigur, aber er kann nichts dafür!« Alles, was wir heute hätten, sei »auf jeden Fall viel, viel besser als bei Hitler«.
»Aber lange nicht gut genug«, erwiderte ich, als wir einen unserer langen Spaziergänge machten, zu denen er sich die Zeit nahm, um mit mir ausführlich über alles diskutieren zu können. »Es ist doch alles so ungerecht!«
»Das stimmt«, gestand er mir zu, »aber die meisten Menschen sehen das nicht. Sie werden es aber erst ändern, wenn sie es sehen.«
»Aber warum sehen sie es nicht«, entgegnete ich, »es ist doch ganz offensichtlich, ich kann es doch auch sehen, der Pfarrer sagt es in der Predigt, ihr schreibt es in den Zeitungen – jeder weiß es!«
Heinz Höfl lächelte.
Wir liefen durch die »Parkstadt«, an der ich auf meinem Schulweg nach Schwabing immer vorbeifuhr und von der ich gedacht hatte, dass dort nur Parkhäuser für Autos seien – dabei war damit gemeint, dass zwischen den Hochhäusern viele Wiesen lagen und Bäume gepflanzt waren. Die Häuser waren hässlich und wirkten eher wie Parkhäuser für Menschen. In einem von ihnen wohnte er mit seiner Freundin Lisl.
»Sie wollen es nicht sehen«, meinte Heinz Höfl schließlich, »weil es ihnen so gut geht. Aber wenn sie das Elend der anderen sähen, dann könnten sie ihren Luxus nicht so genießen.«
»Ja, aber das ist doch keine Begründung!«, rief ich. »Das ist doch eine Sauerei, dazu haben sie nicht das Recht!«
»Das mag schon sein«, räumte Heinz Höfl ein, »aber das ändert nichts an den Tatsachen.«
Inzwischen waren wir an seinem »Menschenparkhaus« angelangt und fuhren mit dem Aufzug hoch in den zwölften Stock.
Seine Freundin Lisl öffnete uns die Tür, eine unglaublich nette, stark bayrisch redende Frau; auch Heinz war ein Urbayer und sagte immer, er könne sich nie vorstellen, von München wegzugehen.
Lisl hatte Kaffee und Kuchen vorbereitet und bat uns zu Tisch.
»Wieso seid ihr eigentlich nicht verheiratet?«, fragte ich die beiden endlich, denn das interessierte mich schon lange brennend.
Sie sahen sich an und lächelten.
»Wenn man heiratet, ist es aus«, sagte Lisl schließlich lachend, »dann wird es langweilig.«
Heinz lachte, doch dann wurde er ernst: »Ich kämpfe jeden Tag um die Liebe dieser Frau.«
Sie errötete.
»Das muss so sein«, fügte Heinz hinzu, »sonst stirbt die Liebe ab.«
Lisl nickte.
Da fiel mir etwas ein und ich zitierte Goethe: »Nur der verdient sich Freiheit wie die Liebe, der täglich sie erobern muss!«
Die beiden lachten begeistert und applaudierten: »Bravo! Besser kann man es nicht ausdrücken – du hast haargenau verstanden, worum es geht!«
»Es gibt nichts Schlimmeres«, setzte Heinz Höfl hinzu, »als sich eines anderen Menschen ›sicher‹ zu sein. Und das gilt in besonders hohem Maße, wenn es sich um einen geliebten Menschen handelt.«
»Sicherheit ist tödlich«, sagte Lisl und holte frischen Kaffee.
Heinz Höfl wischte sich den Mund von den Kuchenkrümeln ab. »Vor allem die, die ›ganz sicher wissen‹, was richtig oder falsch ist, sind die Schlimmsten.«
Lisl war mit dem frischen Kaffee zurückgekommen, goss uns ein und fügte spöttisch lächelnd hinzu: »Oder die, die den ›Sinn des Lebens‹ kennen.«
»Der Sinn des Lebens ist, die Welt besser zu machen«, sagte ich, »da gibt es doch überhaupt keinen Zweifel88.«
»Zu versuchen, die Welt besser zu machen«, entgegnete Heinz, »ist eine Selbstverständlichkeit, da braucht’s keinen ›Sinn‹ dazu.«
»Das gehört sich einfach so«, bestätigte Lisl.
»Hast du schon mal einen Roman von Albert Camus gelesen?«, fragte Heinz Höfl.
»Nein«, antwortete ich, »aber ich glaube, die Alten haben was von ihm.«
»Lies doch mal ›Der Fremde‹«, schlug Heinz Höfl vor. »Dann unterhalten wir uns nochmal über den ›Sinn des Lebens‹.«
Zuhause fand ich mehrere Bücher von Albert Camus. Ich begann zu lesen.
Der bayrische Kultusminister hatte eine bahnbrechende Entscheidung gefällt: Es wurden gemischte Klassen eingeführt. Auch bei uns sollten bald Mädchen in die Klassen kommen, wir konnten es kaum erwarten. Aber die Lehrer dämpften uns: Wer sich nur das Geringste gegenüber den Mädchen zuschulden kommen lassen würde, fliege sofort von der Schule.
Eines Tages war es endlich so weit:
Unsere Lateinlehrerin Weinzierl – immer noch dieselbe – kam zum Unterricht in Begleitung eines schönen jungen Mädchens mit langen dunkelblonden Haaren. Sie hieß Angelika Müller, war bisher im Odenwald-Internat gewesen und nun nach München gezogen, weil ihre Mutter eine Stelle als Sängerin an der Staatsoper gefunden hatte. Da ich in der ersten Reihe saß und der Platz neben mir frei war, wurde sie89 neben mich gesetzt.
Ab der dritten Klasse lernten wir Griechisch. Der Lehrer hieß Hötzl, war klein, trug stets graue, schlabbrige Kordhosen und hatte ziemlich lange graue Haare, die ihm oft unkontrolliert in die Stirn fielen. Wenn er in ausholenden Schritten auf dem Gang zum Klassenzimmer wanderte, schwenkte er seine Aktentasche weit aus, als ob er ruderte. Er war streng, aber keiner nahm ihn so richtig ernst, weil er einen Tatterich hatte. Wenn er an die Tafel schrieb, musste er die Kreide sehr fest aufdrücken, damit die Buchstaben nicht zu verzackt aussahen, was aber dazu führte, dass es immer wieder laut quietschte. Wenn jemand deswegen lachte, wurde er fuchsteufelswild, fuhr, die Schreibhand fest auf die Tafel gedrückt lassend, herum und brüllte: »Ruhe!« Ich musste nicht lachen, denn er tat mir leid; ich spürte, dass er traurig war, und litt mit ihm – aber es ließ sich nicht ändern.
Im Pausenhof erzählte eines Tages ein Junge aus einer höheren Klasse, woher Hötzl den Tatterich hatte.
»Der war beim Russlandfeldzug dabei«, wusste der ältere Junge ganz wichtig. »Da hätt’s ihn beinah derwischt«, fuhr er fort, »der kann froh sein, dass er noch lebt!« Die Spannung stieg. Andere aus unserer Klasse, die spürten, dass gerade etwas Bedeutendes verhandelt wurde, kamen hinzu, sodass sich ein dichter Halbkreis um den älteren Schüler bildete.
»Und zwar war des so«, erklärte dieser, »der Hötzl war im Schützengraben am Maschinengewehr. Damit sollte er eigentlich die vorrückenden Russen abknallen, damit es bei uns keinen Kommunismus gibt.«
»Der Hitler war aber viel schlimmer als der Kommunismus«, gab ich zu bedenken.
»Sei staad«90, kanzelte mich der ältere Junge ab und fuhr fort: »Die Russen sind aber nicht gelaufen, sondern mit massenhaft Panzern angerollt gekommen und gegen die konnten unsere Soldaten nix machen mit ihren Maschinengewehren.« Er legte eine weihevolle Kunstpause ein und wir hingen alle an seinen Lippen. »Und so kamen sie näher und näher und schossen aus allen Rohren – schon da hätt’s den Hötzl derwischen können. Aber weglaufen konnt er ja auch nicht – da hättns ihn sauber weggschossn. Und jetzt kommt’s!« Der Junge kniff seine Lippen zusammen und nickte. »Da ist dann ein Panzer genau über den Hötzl im Schützengraben drübergefahren – der Hötzl hat sich total geduckt, damit er nicht derquetscht wird – aber dann ist er genau über dem Hötzl stehenblieben!«
Читать дальше