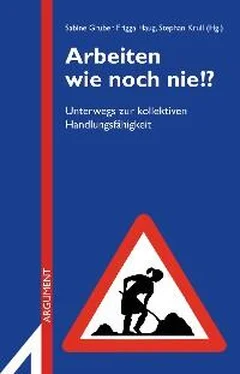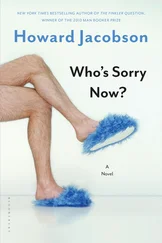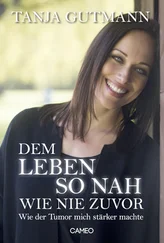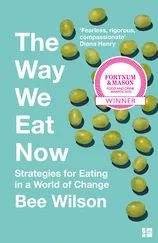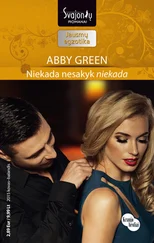Der Philosoph und Jurist Karl Marx (1818–1883) erlebte die erste Hochblüte und das Elend des industriellen Kapitalismus in England. Er setzt der Rechtfertigungslehre der Politischen Ökonomie eine dialektisch verfasste Kritik entgegen und macht deren theoretische Widersprüche sichtbar, die praktisch schon verheerende Wirkung zeigten. Im Gegensatz zu den Nationalökonomen geht er nicht von eigennützigen Wirtschaftssubjekten aus, die auf anonymen Märkten ausschließlich rational handeln, sondern von gesellschaftlich verankerten und schöpferisch ausgerichteten Wesen. Die Verbindung zu den Mitmenschen und den Produkten der eigenen produzierenden Tätigkeit als natürliche Notwendigkeit geht jedoch durch die Zerlegung des Arbeitsprozesses in Teilverrichtungen und durch den Austausch der Waren auf anonymen Märkten verloren. Marx spricht von Entfremdung. Weil menschliche Arbeit als Arbeitskraft gedacht und von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt bestimmt wird, scheint es legitim, die Löhne möglichst niedrig zu halten, um den Profit maximieren zu können. Der Gewinn kann aber nicht von allen angeeignet werden, sondern fließt den Unternehmern als Profit zu. In seiner Arbeitswertlehre zeigt Marx den Doppelcharakter entfremdeter Arbeit auf. Die von den Arbeitern in den Fabriken hergestellten Waren haben einen Gebrauchswert und einen Tauschwert. Ihre Widersprüchlichkeit macht es möglich, dass die Arbeiter über die Löhne (den Tauschwert ihrer Arbeitskraft) weniger rückvergolten bekommen als sie an Wert produzieren. Die Differenz ist der Gewinn des Unternehmers. Darin steckt auch die schon bei Smith formulierte Erkenntnis, dass letztlich jede Wertproduktion auf menschlicher Arbeit beruht. Aus Kapital kann nicht mehr Kapital werden ohne menschliche Arbeit, auch wenn es an den Börsen so aussieht. Trotzdem haben die Arbeitskräfte, die den Wert schaffen (egal wie weit die Produktion ausgelagert wurde), eine schlechte Verhandlungsposition, weil sie nicht Eigentümer der Produktionsmittel sind und weil immer auch Menschen ohne Erwerbsmöglichkeiten für potenziell niedrigere Löhne zur Verfügung stehen. Marx bezeichnet die Arbeitslosen als industrielle Reservearmee (vgl. Stichwort industrielle Reservearmee, HKWM 6/II). Sie spielt eine wesentliche Rolle zur Steuerung der Preise, weil sie als Repressalie dient, die Löhne immer wieder zu drücken. Mit den Arbeitslosen bekommt die Kehrseite des kapitalistischen Profitstrebens ein Gesicht. Die Ungerechtigkeit ist nicht nur moralisch zu verurteilen, sie stellt auch einen Krisenfaktor dar. Marx bettet seine Überlegungen zur Lohnarbeit in den für den Kapitalismus typischen Akkumulationsprozess ein, die zwingend notwendige Anhäufung und Re-Investition von Kapital in profitträchtige Wirtschaftssektoren. Die Triebfeder dafür ist die Konkurrenz auf den Märkten; sie führt zu Spekulation und unersättlichem Profitstreben. Daher ist die kapitalistische Produktionsweise auf Profit und Gewinnmaximierung ausgerichtet. Um die Produktivität zu steigern sehen sich die Kapitalisten gezwungen, die Produktionskosten zu senken (z. B. durch Ersetzung lebendiger Arbeit durch Maschinen, die langfristig preisgünstiger sein sollen). Durch die Automatisierung produziert der Kapitalismus jedoch für ihn »überflüssige« Esser, die erhalten werden müssen; noch dazu fallen sie als Konsumenten aus. Das Dilemma stellt sich so dar, dass diejenigen, die als Konsumenten für die Profite sorgen sollten, nun aus- und zur Last fallen (vgl. Das Kommunistische Manifest, MEW 4). D. h. die sich immer wieder auffüllende Reservearmee hat kurzfristig Vorteile für das Kapital, weil sie hilft, die Lohnkosten niedrig zu halten. Kippt der Wachstumsprozess jedoch aufgrund von Unterkonsumtion, weil den Arbeitslosen das Geld für den Konsum fehlt, werden die Nachteile als allgemeine Wirtschaftskrise sichtbar. Im Widerspruch der Entwicklung der Produktivkräfte und der Konsumkraft der Massen liegen eine zentrale Erklärung der periodischen Wiederkehr von Krisen und ein selbstzerstörerisches Moment des auf Wachstum angewiesenen Kapitalismus. Darüber hinaus greifen andere Faktoren (wie sinkende Profitraten und Geldentwertung) in Krisenzeiten rasch ineinander. Von Marx können wir lernen, dass Wachstum nie linear und störungsfrei verläuft. Da einzelbetriebliche Planung und maximiertes Profitstreben letztlich immer zu Über- und Fehlproduktion führt, können Krisen auch als Selbstreinigungsprozess des Kapitalismus interpretiert werden. Nach der Vernichtung von Kapital in Form von mit Firmenschließungen verbunden Entlassungen kann die Profitrate wieder steigen, und die Wachstumsspirale beginnt von vorne. Von Selbstregulationsfähigkeit der Märkte im Sinne einer gerechten Verteilung kann aber nicht gesprochen werden; sie wurde bis heute nicht eingelöst. Am meisten spüren zyklisch vorprogrammierte Konjunkturschwankungen und Krisen jedoch die Arbeiter, an die sie als Lohnkürzungen oder Entlassungen weitergegeben werden.
Verwunderlich ist jedoch, dass wir spätestens seit Marx von der Instabilität und Krisenanfälligkeit der kapitalistischen Wirtschaftsweise wissen müssten. Dennoch scheint jede Krise wie ein unerwartetes Ereignis über uns hereinzubrechen bzw. wurden bis heute nur unzureichende Lösungen entwickelt. Da sich die kapitalistische Logik inzwischen auf alle Teilbereiche unserer Gesellschaften ausgeweitet hat, wo Waren oder Dienstleistungen hergestellt werden – also auch die Bereiche Bildung, Gesundheit, Infrastruktur, staatliche Verwaltung usw. (die Privatisierung und »Vermarktlichung« wird auch Kommodifizierung genannt) – und sich der Kapitalismus nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Blocks auf fast alle Länder ausgeweitet hat, hat sich auch der Krisenzyklus zu multidimensionalen Krisen ausgewachsen: als Folge und Prinzip des Wachstumszwangs. Was als Krise der Arbeitsgesellschaft bezeichnet wird, ist nur eine Sichtweise auf die Gesamtproblematik kapitalistischen Wirtschaftens. Die heutige Erwerbsgeneration müsste sich zumindest an die Vorboten der aktuellen Weltwirtschaftskrise erinnern können, die in Gestalt der Ölkrise Anfang der 1970er Jahre die sozialen und ökologischen Wachstumsgrenzen deutlich vorführten. Auch Spekulationen sind an sich nichts Neues, allerdings ist das Ausmaß der Blasen durch die Risikoanlagen (z. B. Hedgefonds, Leerverkäufe) seit den 1980er Jahren vermutlich größer als das in der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre der Fall war5.
Bisherige Krisenbewältigungsversuche
Die bisherigen Krisenbewältigungsversuche ergeben sich aus den oben vorgestellten normativen und kritischen Denkschulen. Marx und Engels erarbeiten eine Kritik der Politischen Ökonomie. Eine Chance, die Entfremdung aufgrund profitorientierter anonymer Austauschprozesse aufzuheben, sehen sie in der kommunistischen Perspektive (vgl. dazu u. a. Das Kommunistische Manifest, MEW 4). Für Marx und Engels und spätere Marxisten ist die Abschaffung des privaten Eigentums an Produktionsmitteln (z. B. Grund und Boden, Gebäude, Maschinen und Werkzeuge) eine Schlüsselfrage. Als Alternative schlagen sie eine gesellschaftliche Planung der Produktion und die Verwaltung der Produktionsmittel als gesellschaftliches Eigentum vor. Statt der Anhäufung des Mehrwerts durch wenige Eigentümer sollen kooperativ gestaltete Entscheidungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten die Aneignung der Produkte entsprechend den Bedürfnissen der Menschen ermöglichen. Weil jeder weiß, für wen er produziert, kann er im Sinne einer bedarfsorientierten Verteilung der Einkommen mitentscheiden.
Das »Kommunistische Manifest« fiel im leidgeplagten Russland auf politisch fruchtbaren Boden. Nach der Oktoberrevolution 1917 begannen die Bolschewiki mit dem Aufbau des Sozialismus in einem noch zaristisch-feudal geprägten Land. Aus heutiger Erfahrung wissen wir, dass die Kernideen zwar realisiert, kein Eigentum an Produktionsmitteln herrschte, die gemeinschaftliche Verwaltung in der Praxis aber nicht verwirklicht wurde. So scheiterte der Sozialismus u. a. am Mangel an Demokratie. Mit den diktatorischen und blutigen Auswüchsen des Stalinismus wurden auch die Hoffnungen, die vom Ideal der klassenlosen Gesellschaft ausgingen, weitgehend zerschlagen.
Читать дальше