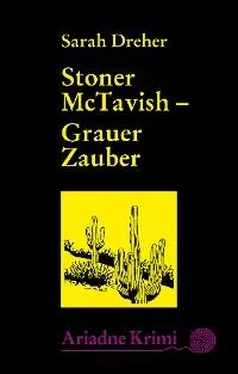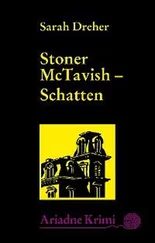Sarah Dreher - Stoner McTavish - Grauer Zauber
Здесь есть возможность читать онлайн «Sarah Dreher - Stoner McTavish - Grauer Zauber» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Stoner McTavish - Grauer Zauber
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Stoner McTavish - Grauer Zauber: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Stoner McTavish - Grauer Zauber»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Stoner McTavish - Grauer Zauber — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Stoner McTavish - Grauer Zauber», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Oder es lag an der Luft, ausgedörrt wie in einem Wäschetrockner.
Oder am Licht, das jetzt durch die schrägstehende Abendsonne aufdringlich golden war.
Oder an der Art, wie der Wind den Staub aufwirbelte und tanzen ließ.
Oder vielleicht an der Landschaft, der endlosen Leere, dem Boden, der sich auf beiden Seiten der Straße erstreckte, so kahl, als ob eine Flutwelle darübergefegt wäre und das Land freigeschrubbt hätte von Salbeigestrüpp und Bäumen und Büschen und allen anderen Lebensformen, die hier noch zu existieren versuchten.
Nach Westen hin erstreckten sich niedrige Hügel aus gepresstem Ton und Schiefer, voll purpurner Schatten, aufgefaltet, von tiefen Rinnen durchschnitten, dabei weich wie Schlagsahne. Im Osten Berge. Im Norden die Silhouetten von Mesas, die sich vor dem Himmel abzeichneten.
Ein kleines Blockhaus, achteckig, mit dem Eingang nach Osten, stand im Schatten eines einzelnen Felsens. Ein Blechschornstein ragte aus dem Lehmdach. Eine ausgefranste Decke hing über der Tür. In der Nähe pickte ein Rabe nach etwas Unsichtbarem.
»Hogan« , erklärte Stell, »ein Navajo-Haus. Wahrscheinlich leer. Sie gehen im Sommer mit den Schafen in die Canyons. Navajo machen herrliche Teppiche, wisst ihr. Sie weben und färben die Wolle selbst. Nördlich und westlich von hier, entlang der Straße zum Grand Canyon, könnt ihr sie an der Fahrbahn sitzen und weben sehen. Stellen ihre Webstühle mitten in die knallende Sonne, Bäume gibt’s da ja kaum. Von Zeit zu Zeit baut mal einer der Männer seiner Frau einen Schirm, der die Sonne abhält, aber solche Männer sind selten. Was beweist, dass die Völker sich ähnlicher sind, als wir oft denken.«
Sie waren jetzt tief in der Wüste, hatten die asphaltierte Straße längst hinter sich gelassen, runter von der Navajo Route 15, auf festgefahrenen Sand und Erde. Der Himmel dehnte sich über ihnen und um sie herum, nahm kein Ende. In weiter Entfernung stand eine Windmühle, reglos. Ein Wolkenfetzen hing in der blauen Luft wie ein verschmierter Fingerabdruck. Weit und breit kein Zeichen von Leben.
»Wir haben euch in der Baracke untergebracht«, sagte Stell, »es ist eng und nichts Tolles, aber ich dachte mir, eure Ruhe ist euch lieber als irgendwelche anderen Vorzüge. Wenn’s euch nicht gefällt, könnt ihr gerne ins Gästezimmer umziehen.«
»Es ist sicher genau richtig«, sagte Gwen.
Stell warf ihr einen Blick zu. »Eine Sache möchte ich noch klarstellen, bevor ein Problem daraus wird. Stoner ist für mich wie Familie, und damit bist du auch Familie. Lassen wir also unnötige Höflichkeitsformen weg.«
»Sie kann nichts dafür«, sagte Stoner, »sie ist in Georgia erzogen.«
Gwen schwieg und schaute auf ihre Hände hinunter.
»Hab ich was Falsches gesagt?«, fragte Stoner.
Gwen schüttelte den Kopf. »Ich dachte gerade an meine Großmutter. Sie würde mich in die Baracke stecken und Stoner ins Gästezimmer. Oder umgekehrt.«
»Ich werde nie verstehen«, sagte Stell und drückte Gwens Handgelenk, »wie erpicht manche Leute darauf sind, um alles ein Riesengetue zu machen. Verflixt, ich hab doch genug damit zu tun, meinen Tag auf die Reihe zu kriegen.«
»Tja«, sagte Gwen, »du bist aber die Ausnahme.«
Links von ihnen tauchte ein heruntergekommenes Durcheinander von Gebäuden auf. Eine Hütte aus Kiefernlatten, direkt daneben eine Doppelgarage mit einem Blechdach, das über die Straße ragte und ungefähr einen halben Meter Schatten bot. Geweihe und Kuhschädel und andere Souvenirs des Todes hingen zwischen den Dachrinnen. Ein Fuchsfell war an die Garagenwand genagelt. Draußen rosteten zwei Texaco-Zapfsäulen ihrem Ende entgegen. Ein handgeschriebenes Schild, das an der Hüttenwand lehnte, verkündete ›Begays Texaco, Reifenreparatur‹. Verstreute Reifen und Felgen zeugten davon, dass bei Begay jedenfalls irgendwas mit alten Reifen passierte.
Stell sauste in einer Staubwolke und mit einem freundlichen Hupen vorbei. »Mr. Begay ist eine ziemliche Schande, aber wir versuchen miteinander auszukommen, weil dieser Müllhaufen und die Handelsstation das ganze Dorf Spirit Wells bilden. Und er hat das einzige Benzin zwischen hier und Beale.« Sie lachte. »Wo wir gerade von Getue sprachen …«
»Es gibt für alles Grenzen«, sagte Stoner. Die abgerissene Gittertür, die zu der Hütte führte, war schwarz von Fliegen gewesen.
Ein langes, niedriges Gebäude erschien in der Ferne, eng an den Fuß einer Mesa geschmiegt. Die Sonne schimmerte kupferfarben in den Fenstern. Eine lange Veranda säumte die Westseite. Als sie näher kamen, konnte sie dort Bänke und Schaukelstühle erkennen, eine Tür, die nach innen offenstand, und ein verwittertes Schild. Spirit Wells Handelsstation. Gegr. 1873. Inh. Gil und Claudine Robinson. Eine Rauchfahne stieg kerzengerade aus dem steinernen Schornstein hoch.
»Da wären wir«, sagte Stell. Sie rümpfte die Nase. »Der Rauch da gefällt mir gar nicht.«
Gwen blinzelte durch die staubige Windschutzscheibe. »Glaubst du, irgendwas stimmt nicht?«
»Schlimmer. Ted macht dieses Feuer immer nur dann vor der Dunkelheit an, wenn er irgendwas brät, das ihm die Indianer als Bezahlung gegeben haben. Das könnte so ziemlich alles sein.«
»Wild?«, fragte Stoner, in der Hoffnung auf die essbarste einer ganzen Reihe von Möglichkeiten.
»Wild, Kaninchen, Klapperschlange. Schwer zu sagen.«
»Ich hab schon sushi gegessen«, sagte Gwen mit schwacher Stimme, »aber nur einmal.«
Sie bogen von der staubigen Straße in die staubige Einfahrt, die kaum von dem staubigen Hof zu unterscheiden war. Flammend blühender Salbei füllte die Blumenkästen. Rote Paprikaschoten hingen an einer Schnur aufgereiht zum Trocknen an der Wand. Die Temperatur fiel im Schatten um fünfzehn Grad.
Die Ruhelosigkeit, die Stoner in ihrem Magen gespürt hatte, zog sich zu einer Art weicher Kugel zusammen, die warm in ihre Schultern und Arme ausstrahlte. Sie hoffte, dass sie sich nichts eingefangen hatte.
Stell hielt vor einer groben Scheune, die gleichzeitig als Garage diente. Neben der Scheune war ein umzäuntes Viehgehege. Es enthielt Pferde.
Sehr große Pferde.
Große, braune, energisch aussehende Pferde.
Stell bemerkte den Ausdruck von Entsetzen in ihrem Gesicht und lachte. »Das sind Maude und Bill. Du brauchst sie nicht zu reiten. Betrachte sie einfach als Teil der Landschaft.«
»Sie lassen sich nicht reiten?«, fragte Gwen.
»Du kannst sie reiten«, sagte Stell, »und ich kann sie reiten. Sie kann sie nicht reiten.«
»Macht euch keine Sorgen um mich«, sagte Stoner, »mir geht’s wirklich prima zu Fuß.«
»Aber«, sagte Stell, als sie aus dem Wagen stieg, »ich wette, wir haben etwas hier, das du mögen wirst.« Sie steckte zwei Finger in den Mund und ließ einen ohrenbetäubenden Pfiff los.
Der größte Hund der Welt, mit dem riesigsten, kantigsten Kopf der Welt, wühlte sich unter der Scheune hervor und warf sich in Stells ungefähre Richtung. Sein Fell war kurz und scheckig. Ein Ohr stand spitz hoch, das andere lag schlaff über seiner Stirn.
»Das hier«, sagte Stell, während der Hund ihr die Vorderpfoten auf die Schultern legte und ihr Ohr ableckte, »ist mein Freund Tom Drooley, halb Deutsche Dogge, halb Bernhardiner und ganz Schosshund.«
»Ich trau mich kaum zu fragen«, sagte Gwen, »aber warum heißt er Tom Drooley ?2«
Stell schob den Hund mit dem Knie auf den Boden zurück und wischte sich das Ohr an ihrem Hemdärmel ab. »Dreimal darfst du raten.«
Tom Drooley trottete um den Wagen herum und begann eine sorgfältige Schnüffelinspektion von Stoners Hosenbeinen. Zufriedengestellt setzte er sich hin, fegte zweimal mit dem Schwanz über den Boden, sah ihr in die Augen und sagte: »Wuff.«
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Stoner McTavish - Grauer Zauber»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Stoner McTavish - Grauer Zauber» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Stoner McTavish - Grauer Zauber» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.