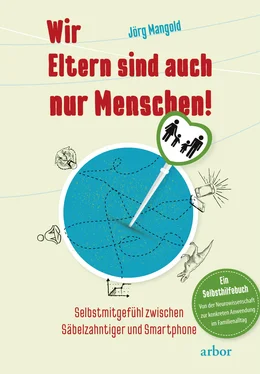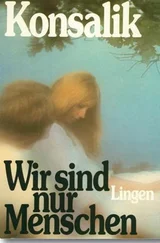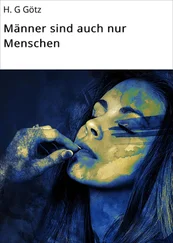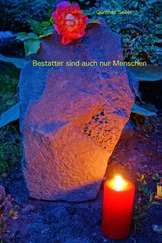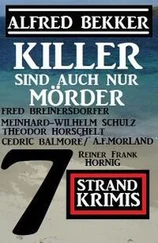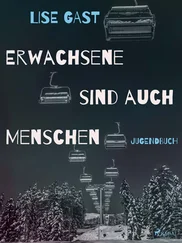Nur ein Wimpernschlag Menschheit

→ Abb. 1.2 Menschwerdung
Mit Blick auf die Erdentstehung erscheint die gesamte Geschichte des Homo sapiens nur wie ein Blinzeln. Noch einmal dramatisch an Fahrt aufgenommen hat die Entwicklung seit der industriellen Revolution vor 200 Jahren. Und in den letzten 30 Jahren der digitalen Revolution wurde unsere Lebensart mit Computern, Internet und Smartphones noch einmal rasant umgekrempelt. Unsere Kinder können sich ein Leben ohne digitale Technik im Wohnzimmer und das Smartphone in der Hosentasche – mit Verbindung zur ganzen Welt – gar nicht mehr vorstellen.
Wenn ich erzähle, dass meine Familie bis ich 10 Jahre alt war noch nicht einmal ein Telefon besaß, komme ich völlig antik daher. Unser Schwarz-Weiß-Fernseher empfing nur drei Programme und spätestens um Mitternacht gab es nur noch das Testbild zu sehen. (Ich erinnere mich gut an den Streit „Daktari versus Sportschau“, den mein Vater immer gewann.)
Wir haben als Menschen ein ganz neues Zeitalter geschaffen, in dem wir uns mit unseren alten und neuen Gehirnanteilen zu behaupten haben. So schnell konnte dieses Organ gar nicht „hinterherkommen“ und auch als Individuum fällt es uns nicht immer leicht.
Später kommen wir noch ausführlicher darauf zu sprechen, dass es auch eine Kehrseite der Medaille dieser neuen Hirnwindungen und menschlichen Denkfunktionen gibt, und welche „unerwünschten Nebenwirkungen“ sich daraus für unsere Psyche ergeben können.
Eine Urwelt voller Gefahren steckt uns noch heute im Kopf
Viele Urbewohner der Erde haben es nicht geschafft, zu überleben und sind im Verlauf der Zeit ausgestorben. Aber das menschliche Gehirn hat sich in einer Art und Weise entwickelt und verändert, die hilfreich war für das Überleben. Anders als in unserer jetzigen Lebenswelt ging es dabei die meiste Zeit um Leben und Tod.
Die Hauptregel war:
»To have lunch or to be lunch!«
also
»Hast du was zu essen oder wirst du gefressen?«
Das hatte Auswirkungen auf das Gehirn. Es hat gelernt, negative Ereignisse stärker zu gewichten. Die Wissenschaftler bezeichnen das als „negativity bias“.
Vielleicht wird uns als Mutter oder Vater am Ende des Tages klar, dass wir einen wirklich blöden Fehler gemacht haben. Daneben könnten uns noch 35 Dinge in den Sinn kommen, die an diesem Tag wirklich gut gelaufen sind. Wenn wir trotzdem grübelnd bei dieser einen Geschichte hängen bleiben, hat das genau damit etwas zu tun.
In der Urzeit war es eben wichtiger, sich die kritischen Lebensereignisse zu merken, etwa zu wissen, wo der Säbelzahntiger kreuzt, als zu speichern, wo die größten Pilze wachsen. Das heißt nicht, dass es nicht prima war, wenn sich einer aus dem Stamm gemerkt hatte, wo die besten Pilze wachsen und dafür auch gelobt wurde. Aber all diejenigen, die sich Gefahren nicht merken konnten, wurden zur Mahlzeit. Unterm Strich führte das zu einer Auslese zugunsten der Menschen mit Angst-, Gefahr- und Krisenspeicher-Gehirnen, die diese Gene für ein starkes Alarmsystem weitergeben konnten. Es haben also die nervösen Angsthasen überlebt, die ständig in Hab-Acht-Stellung waren und überall Unheil lauern sahen.
Kommt uns das irgendwie bekannt vor als Eltern?
Und jetzt wissen wir: Dafür können wir gar nichts! Denn wir haben ein Gehirn im Kopf, das sich evolutionsbedingt an die kritischen Ereignisse besonders gut erinnert.
Dazu kommt noch, dass wir aus uraltem Antrieb unsere Kinder schützen wollen. Es geht ja biologisch auch darum, die eigenen Gene weiterzugeben. Säuger, das wissen wir nun, versuchen dies über intensive Brutpflege zu ermöglichen. Wir Menschen haben das ja zu einem Extrem getrieben: Ab welchem Alter würde unser Kind eine Woche überleben, wenn es im Wald auf sich gestellt ist? Gut, manche Mütter würden sagen nie und manche Väter wären vielleicht mutiger. Aber im Vergleich zu anderen Säugern braucht unser Nachwuchs doch extrem lange, bis er ansatzweise selbstständig ist.
Kritik wiegt schwerer als Lob
Vom reinen Überlebensvorteil bei Gefahr hat sich der evolutionäre „negativity bias“ auch in die Spielregeln des Zusammenlebens unserer Vorfahren eingeschlichen. Heute erleben wir das hautnah, zum Beispiel bei Kritik und negativen Rückmeldungen.
An wie viele Komplimente oder Lob können Sie sich aus dem Stehgreif erinnern? Und wie präsent sind Ihnen dagegen vielleicht viel länger zurückliegende Momente einer beißenden Kritik oder Peinlichkeit?
Darauf, wie wir Kritik wahrnehmen, haben sich auch hunderttausend Jahre Leben in kleinen überschaubaren Stammesgruppen ausgewirkt. Verbannung wäre damals der sichere Tod gewesen und damit wurden kritische Rückmeldungen aus der Gruppe viel überlebenswichtiger als besondere Ehrenpreise. Daher hinterlässt Kritik heute noch so viel stärkere seelische Spuren als Lob.
Ein persönliches Beispiel: Ich unterrichte angehende Psychotherapeuten. Nach einem Wochenendseminar füllen die Teilnehmer Feedback-Bögen aus. Darin bewerten sie mit Schulnoten von eins bis sechs den Dozenten, seine Wissensvermittlung, seine Art vorzutragen und so weiter. In einem der Institute musste ich die Bögen immer selbst einsammeln. Dabei konnte ich der Versuchung natürlich nicht widerstehen und schaute sofort, welche Noten ich bekommen hatte. Damit war das Wochenende regelmäßig ruiniert. Meist waren mindestens 13 von 15 Bewertungen recht gut, aber immer wieder vergaben auch ein bis zwei Teilnehmer eine drei oder vier. Diese wenigen kritischen Bewertungen machten mich fertig und gingen mir auf der ganzen Heimfahrt nicht mehr aus dem Kopf. Wenn später die Gesamtauswertung des Instituts zu dem Seminar kam, war der „Notendurchschnitt“ gut. Irgendwann wurde mir dieses Wechselbad der Gefühle richtig klar und von da an faltete ich die Bögen sofort zusammen, gab sie ohne hineinzuschauen ab und wartete auf die Gesamtauswertung.
Heute, nach einiger Praxis in Selbstmitgefühl, kann ich auch wieder gleich auf die Bögen schauen und mir sagen: „Ach, irgendjemand ist immer unzufrieden, du kannst nicht alle erreichen. Dafür sind die Menschen zu unterschiedlich. Wenn die Mehrheit zufrieden ist, dann bin ich das auch.“ Ich weiß also aus eigener Erfahrung, dass Kritik manchmal schwerer wiegt als Lob.
Rick Hanson, ein US-amerikanischer Neuropsychologe, meint, dass Kritik fünfmal stärker wahrgenommen wird als Lob. Bei mir war das sicher eher im Verhältnis 10:1. Aber herauszufinden, dass die historische Ausrichtung meines Gehirns da mitspielt und ich nicht besonders überempfindlich bin, hat mir geholfen. Es ist auch gut zu wissen, dass ich selbst etwas dafür tun kann, um dieser Negativ-Tendenz entgegenzusteuern oder sie gar auszugleichen. Ich kann mit einem selbstfreundlichen Geist meinem Gehirn neue Pfade beibringen und diese festigen.
Was hat das alles mit dem Elternsein zu tun?
Greifen wir das Verhältnis „Kritik zu Lob“ auf. Eine kleine Mathe-Aufgabe für Eltern:
Gehen wir davon aus, dass uns Kritik und Lob im Verhältnis 5:1 berühren. Jetzt rechnen wir mal hoch, wie oft wir im Alltag unser Kind kritisieren beziehungsweise korrigieren und wie oft wir es loben. Diese Rechnung ist wichtig, weil ja auch Kinder im Sinne des „negativity bias“ kritische Anmerkungen viel stärker wahrnehmen. *Die Negativtendenz ist ein Sinnbild dafür, dass wir bei so vielem – was wir denken, fühlen und wie wir reagieren – von einem Gehirn gesteuert werden, das sich über Millionen von Jahren zum Überleben in einer völlig anderen Welt ausgebildet hat. Je mehr wir im Alltagsleben gestresst oder unter Druck sind, desto eher geraten wir in den „Dinosaurier-Modus“. Wir schalten automatisch und vorbewusst auf diese uralten Hirnanteile und ihre Not- und Überlebensprogramme zurück.
Читать дальше