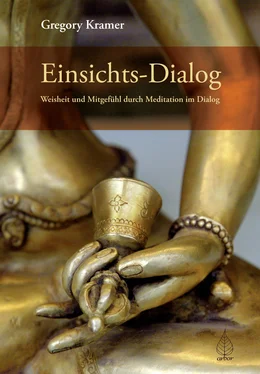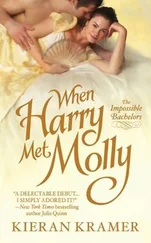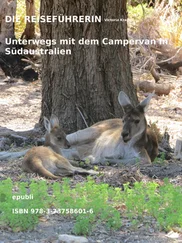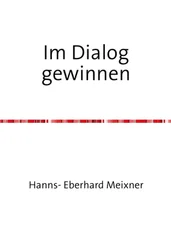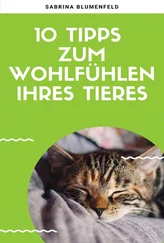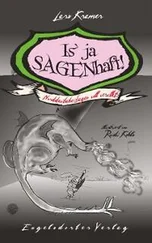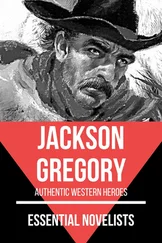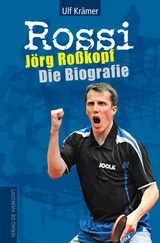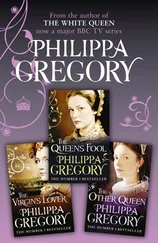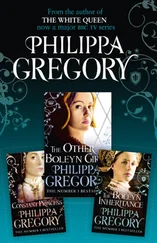1 ...8 9 10 12 13 14 ...18 Ob nun das Ergebnis von Karma, DNS oder starken neuronalen Verschaltungen, dieses Greifen und Klammern wurzelt in einer Geschichte, die unvorstellbar subtil ist. Weil Geist und Körper ein untrennbar Ganzes sind, manifestiert sich dieser schmerzhafte und aufgewühlte Zustand des Greifenwollens in Körper und Geist. Die Begegnung mit einem anderen Menschen ist eine besonders eindringliche Form des Kontakts und kann zu mächtigen, subtilen und komplexen Gefühlen führen. Aus diesen Eindrücken entsteht der Drang zu greifen, etwas Zähes im Herzen und Denken, das in jedes Zusammensein eine gewisse Beunruhigung bringt und Trennung schmerzhaft macht.
Wenn Sie das nächste Mal in einer ihrer Beziehungen Leiden bemerken, prüfen Sie, ob Sie das Greifenwollen darin erkennen. Halten Sie an einem Bild, dem Wunsch nach Kontrolle, einer Hoffnung oder einer Angst fest? Wenn Sie es bemerken, verändert sich dadurch der Schmerz oder das Greifenwollen?
Drei Arten elementaren Hungers
Als der Buddha den Mechanismus dieser Zyklen von Schmerz und Zwang auslotete, erkannte er als ihre Quelle drei miteinander verbundene Arten des Hungers. Er sagte:
Dies, Mönche, ist die Edle Wahrheit vom Ursprung des Leidens: Es ist der Wiedergeburt bewirkende, mit Freude und Vergnügen verbundene Hunger ( tanhâ ), der mal hier, mal dort Gefallen findet, nämlich: der Hunger nach Lust, der Hunger nach Werden, der Hunger nach Vernichtung. 13
Als ich zum ersten Mal auf diese Aussage stieß, verstand ich sofort, wie der Hunger nach sinnlicher Lust und die implizite Aversion gegen Schmerz zu allen möglichen Frustrationen und Sorgen führen kann. Den Hunger nach Werden, nach Sein verstand ich als körperlichen Überlebenstrieb, aber da normalerweise mein körperliches Überleben nicht direkt gefährdet war, fragte ich mich, ob diese Lehraussage auch für jeden konkreten Moment des Lebens etwas zu bedeuten hatte. Der Drang nach Vernichtung, nach Nicht-Sein war mir ein völliges Rätsel, abstrakt und schleierhaft. Ich glaubte schon, dass er für mein Leben irgendwie relevant war, aber ich fragte mich, ob ich ihn jemals verstehen würde. Nachdem ich ein bisschen mehr studiert hatte, sah ich im Hunger nach Nicht-Sein den Drang, diesem schmerzhaften Leben zu entfliehen – den Selbstmord-Gedanken; obwohl ich wiederum nicht wusste, was das mit meinem Leben zu tun hatte.
Als ich zu verstehen begann, dass Leiden das zwischenmenschliche Leiden beinhaltet, und den Ursprung dieses Leidens im zwischenmenschlichen Hunger erblickte, wurden die Lehraussagen des Buddha für mich plötzlich lebendig. Und als ich sah, wie diese drei Arten des Hungers im zwischenmenschlichen Bereich wirksam waren, vertiefte sich auch mein Verständnis ihrer persönlichen Dimension. Ich begann das Lechzen nach zwischenmenschlicher Befriedigung als Drang nach angenehmer Anregung durch andere Menschen zu verstehen, aber auch als Angst vor Einsamkeit, die durch diesen Lustgewinn oft übertüncht wird. Ich sah, dass der Hunger nach Werden auch der Hunger war, in einer Beziehung „da zu sein“ – das heißt, der Hunger danach, gesehen zu werden, und seine Kehrseite: die Angst, unsichtbar zu sein. Der Hunger nach Nicht-Sein, begann ich zu verstehen, war nicht nur der Drang, diesem verrückten und schmerzhaften Leben zu entfliehen, sondern auch der Drang, dem Dasein in einer Beziehung zu entfliehen. In diesem Drang, so sah ich, steckt die Angst vor dem Gesehen-Werden, die Angst vor Nähe 14.
Allmählich verstand ich diese Arten des Hungers fast als Naturgewalten, die mich in Verwirrung und Stress gefangen hielten, weil ich von ihrem Wirken gar keine Ahnung hatte. Ich ahnte, dass unter dieser Düsternis schon immer Klarheit und Ruhe existiert hatten, auch wenn ich nicht wusste, wie ich dazu Zugang finden konnte. Es schien, als hätte jedes dieser drei Hungergefühle in meinem Herzen irgendwie ein Plätzchen reserviert, noch bevor elterliche Konditionierung oder Kognition an meiner ursprünglich strahlenden Bewusstheit herumdokterten.
Wie das Beziehungs-Selbst sich bildet
Ein Schlüsselelement in unseren konditionierten Reaktionsmustern – vielleicht das stärkste – ist das Gefühl eines Selbst oder Ich. Nach der Geburt hängt unser Überleben von anderen Menschen ab. Wir treten in eine Welt voller Empfindungen ein: Berührung mit harten und weichen, warmen und kalten Gegenständen. Reflexartig zieht es uns zu den Empfindungen, die wir angenehm finden, und wir wenden uns ab von denen, die wir unangenehm finden. Wie alle Tiere lernen wir. Wir lernen, wo es weich ist, und lernen, uns dort einzukuscheln; wir lernen, uns von lauten Geräuschen fernzuhalten. Wir suchen die Wärme und Fürsorge der Brust und weinen danach, verkrampft und um unser Leben schreiend. Von Wärme und Milch gestillt, entspannen wir uns. All das gehört dazu, wenn man als sensibles Wesen in eine anregende und wechselhafte Umwelt hineingeboren wird.
Mit drei Lebensmonaten in diesem Körper fangen wir an zu unterscheiden, was „ich“ ist und was nicht. Wir stellen fest, dass dieses Nicht-Ich reagiert. Die Brust ist nicht nur weich, sie wird auch dargeboten. Unser Beziehungsleben hat begonnen. Wir gehen daran, kennenzulernen und kennengelernt zu werden; das soziale Lächeln beginnt. „Halloooo“, sagt der neue Papa. Augen begegnen sich. Der Vater lächelt und das Kind lächelt bei diesem Erkennen, sein ganzer Körper dehnt sich wie ein grinsender Luftballon. Kontakt! Geschafft.
Dieser Kontakt wird eine Schlüsselerfahrung, während eine Flutwelle des Lernens anrollt. Unser Gehirn bildet fast zwei Millionen neue Synapsen pro Stunde. Das Gedächtnis bildet Verbindungen zwischen reiner Empfindung und menschlichen Interaktionen. In seinen Publikationen zur zwischenmenschlichen Neurobiologie berichtet Daniel Siegel über Forschungsergebnisse, wie unser Gehirn durch die Interaktion mit anderen konfiguriert wird. 15Wir lernen, uns bei bestimmten Menschen sicher und geborgen zu fühlen und werden ihnen gegenüber anhänglich, lächeln, gurren und wollen gefallen. Wir werden Fremden gegenüber misstrauisch und verkrampfen uns, wenn wir wütende Stimmen hören. Diese Muster helfen uns, die nötige Fürsorge zu bekommen und Gefahren zu meiden. Zusammen mit ihnen entsteht das Gefühl eines „Ich“. Um die Spannungen durch sensorischen und beziehungshaften Kontakt herum gruppiert und neugruppiert sich ein vorläufiges „Selbst“, indem wir angenehme Gefühle ersehnen und unangenehme wegschieben. Mit zwei Jahren haben wir das überaus zweischneidige Schwert eines eigenständigen Selbstgefühls entwickelt.
Wie es für meine Mutter und meinen Vater war, war es auch für mich, und so ist es auch für meine Söhne. Wir haben alle ein Selbst entwickelt, das Konstrukt einer Sichtweise, die einen emotionalen Kern unseres Lebens stützt. Wenn dieses Selbstgefühl einmal ausgebrütet ist, wird das Konstrukt von jeder Empfindung weiter genährt. Es gibt nicht mehr einfach Sehen, sondern „ich sehe“. Mein Sohn Jared verspürt nicht einfach Hunger, er spürt „ich habe Hunger“. Von großer Tragweite für unser künftiges Glück und Leid ist, dass es nicht einfach den Anblick und die Geräusche von Leuten gibt: Da bist du, unabhängig von mir; da bin ich, unabhängig von dir. Wo es voneinander unabhängige Ichs und Dus gibt, gibt es Getrenntheit und Unterschiedlichkeit, und diese werden zur Grundlage von Beziehungen.
Wenn wir älter werden, beziehen wir uns nicht nur auf einzelne Menschen, sondern allgemein auf unsere Altersgenossen und unsere Kultur insgesamt. In der Adoleszenz konstruiert dieses sich bildende Selbst durch Imitation und Vergleich unser soziales Selbst. Mit fünfzehn lernte mein Sohn Max die Normen des Clans, die Regeln sozialer Begegnung. „Was sieht gut aus? Wie kann ich mithalten? Welches Verhalten wird mit Freundschaft und Lob belohnt? Welches führt zu Verurteilung und Ablehnung?“ Dieses Lernen wird bis ins Erwachsenendasein fortgesetzt; mit vierundzwanzig fragte mein Sohn Zed Sachen wie: „Wie kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen?“ - „Wie gewinne ich einen Partner?“ - „Wie verschaffe ich mir Respekt?“ Unser Selbstgefühl wird verstärkt, während wir mit dem Gefühl klarzukommen versuchen, ein klar abgegrenztes, in eine Gemeinschaft eingebettetes Individuum zu sein, das nach körperlichem und sozialem Überleben und Glück strebt. Das Gefühl der Getrenntheit und Unterschiedlichkeit wird vollständig verdinglicht.
Читать дальше