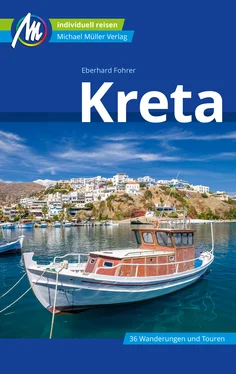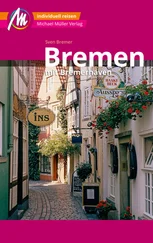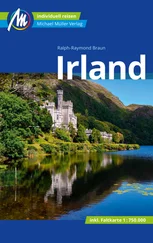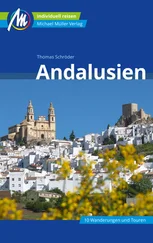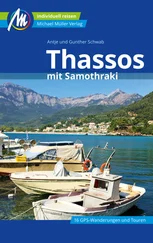Venezianische Stadtmauer
Der gewaltige, 3 km lange Mauergürtel mit sieben groß angelegten Bastionen zieht sich um die ganze Innenstadt. Er folgt in Teilen dem Verlauf einer früheren byzantinischen Mauer, die allerdings von der heutigen Platia Eleftherias aus quer durch die heutige Innenstadt entlang der Dedalou Str. zum Morosini-Brunnen und von dort entlang der Chandakos Str. zum Wasser verlief und abgerissen wurde. Reste dieser älteren Mauer hat man an der Chandakos Str. entdeckt. 1462 begannen die Venezianer mit der Verstärkung der alten Befestigungen, 1550-60 ließ der Veroneser Stararchitekt Michele Sanmicheli das mächtige Verteidigungswerk in seinem heute noch bestehenden Ausmaß errichten. Eine rigorose Arbeitspflicht ermöglichte dies: Jeder Kreter im Alter von 14 bis 60 Jahren musste eine Woche pro Jahr an der Mauer arbeiten, außerdem zwei Steinquader oder steinerne Kanonenkugeln mitbringen.
Heute sind Mauer und Bastionen mit windzerzausten Pinien und verdorrtem Gestrüpp teilweise dicht bewachsen, Spazierwege führen an manchen Stellen durch die Wildnis. Unterhalb der Platia Eleftherias und der Vitouri-Bastion kann man den begrünten Graben begehen. Schönstes Tor ist die Porta Chaniá im Westen, das so arabisch wirkt, dass die BBC hier einen Spielfilm über Jerusalem gedreht hat. Ebenfalls eindrucksvoll ist die mit Steinmetzarbeiten versehene, tunnelähnliche Porta Kenoúria neben der Jesus-Bastion - sie ist das neueste Tor der Stadtmauer und wird deshalb auch „New Gate“ genannt.
Marengo-Bastion und Kazantzákis-Grab: Die südlichste Stelle der Befestigung kann man vom Zentrum aus in etwa 15 Fußminuten erreichen. Hoch oben auf der Bastion liegt Níkos Kazantzákis begraben (1883-1957), weltbekannt geworden durch seinen „Aléxis Zórbas“, der aber nur eines seiner vielen Werke war. Wenige Meter entfernt liegt auch seine Frau Eléni, die 2004 im Alter von hundert Jahren verstorben ist. Ein schmuckloser Grabstein mit einem schlichten Holzkreuz und einer kleinen Bronzetafel, auf der das Wort „Friede“ in verschiedenen Sprachen eingraviert ist - das ist alles, was auf die letzte Ruhestätte Kazantzákis' hinweist. Hinter den Häusern der Stadt lugt das Meer hervor, landeinwärts erhebt sich der sagenumwobene Joúchtas (→ Link), dessen Profil verblüffend einem schlafenden Menschen ähnelt. Angeblich ruht dort Göttervater Zeus.
Kazantzákis war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Minister und ist bis heute eine der populärsten Persönlichkeiten der jüngeren kretischen (und griechischen) Geschichte. Gestorben ist er am 26. Oktober 1957 in Freiburg im Breisgau an der asiatischen Grippe. Iráklion ehrte ihren großen Sohn am 4. November mit einer Totenmesse in der Kathedrale des heiligen Minás und einem anschließenden Leichenzug zum Grab auf der höchsten Bastion der Stadt.
Archäologisches Nationalmuseum
Das bedeutendste Museum Kretas präsentiert sich seit einigen Jahren im neuen, moderneren Gewand. Von der Jungsteinzeit bis zur römischen Besetzung gibt es eine überwältigende Zahl von Exponaten, den Schwerpunkt bilden aber natürlich die Minoer und ihre Kultur.
Zahllose Highlights sind ansprechend präsentiert, vom Diskos von Festós bis zur Schlangengöttin, vom Stierkopf bis zum Sarkophag von Agía Tríada und auch die herrlichen Wandfresken aus dem Palast von Knossós sind hier zu finden.
Museumsdidaktisch hat sich mit der Renovierung einiges geändert. Waren vorher die berühmtesten Stücke exponiert in nummerierten Vitrinen ausgestellt, sind sie jetzt unter thematischen Oberbegriffen wie „Handel und ausländische Einflüsse“, „Religion“ oder „Produktion“ eingebettet in den Kontext ihrer Zeit und werden bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr gesondert hervorgehoben.
Die Kultur der Minoer ist runde 3500 Jahre alt, wesentlich älter also als die antiken Hellenen und Römer. Was bis heute entdeckt wurde, ist nicht mehr als die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs. Das meiste ist unwiederbringlich zerstört, geplündert, verbrannt oder liegt noch tief im harten kretischen Boden verborgen, oft unter bis heute bewohnten Siedlungen und Städten (z. B. Archánes und Chaniá). Die archäologische Sammlung in Iráklion kann so nur einen Eindruck von der Vielfalt und dem Reichtum vermitteln, der damals auf dieser Insel geherrscht haben muss.

Im Mittelpunkt des Interesses: das minoische Stierspringerfresko
Um einen Bezug zu den Gebrauchsgegenständen, Schmuck und Hausrat der Minoer zu finden, sollte man es nicht mit dem Besuch der Ausstellung bewenden lassen, sondern zusätzlich auch einige der Fundstellen besuchen, z. B. Knossós oder Festós, diese uralten Paläste einer in vielem bis heute rätselhaften Zivilisation.
Öffnungszeiten April bis Okt. tägl. außer Di 8-20 Uhr (Di ab 10 Uhr); übrige Zeit tägl. außer Di 8-18 (Di ab 10 Uhr). Eventuelle Änderungen unter odysseus.culture.gr.
Eintritt ca. 12 € (Nov. bis März 6 €), Senioren über 65 J. sowie Schül./Stud. und Pers. von 6 bis 25 J. aus Nicht-EU-Ländern 6 €, freier Eintritt für Pers. bis 25 J. und Schül./Stud. aus EU-Ländern.
Fotografieren ohne Blitz erlaubt, Stativ verboten. Tel. 2810-279000.
Kombiticket mit Knossós April bis Okt. (drei Tage gültig) ca. 20 €, für Schül./Stud. aus Nicht-EU-Ländern 10 € (im Winter 12 €/6 €).
Online-Ticket unter etickets.tap.gr
Freier Eintritt Nov. bis März am ersten So im Monat, außerdem am 6. März, 18. April, 18. Mai, European Cultural Heritage Day (letzte Sept.-Woche) und am 28. Okt.
Besichtigung: Die Sammlung ist chronologisch aufgebaut. Im Erdgeschoss liegen zwölf Säle, die z. T. nur durch Pfeiler getrennt sind, weitere im Obergeschoss, wo vor allem die berühmten Fresken von Knossós alle Blicke auf sich ziehen. Einige besonders markante Exponate sind im Folgenden hervorgehoben.
Erdgeschoss
Neolithikum, Vorpalastzeit und Altpalastzeit (7000-1700 v. Chr.), Saal 1 bis 3: Die Funde aus Neolithikum/Jungsteinzeit (ab 7000 v. Chr.) und Vorpalastzeit (2600-1900 v. Chr.) wurden vor allem in Gräbern und Kulthöhlen entdeckt, die Stücke der Altpalastzeit (1900-1700 v. Chr.) stammen dagegen hauptsächlich aus den frühen Palästen von Knossós und Mália und den Gipfelheiligtümern. Die Kultur Kretas stand damals schon auf hoher Stufe: Die Insel war dicht besiedelt, die ersten Paläste und Städte entstanden, Handel und Handwerk florierten.
Die früheste Keramik wurde noch ausschließlich mit den Händen gefertigt, doch dank der Erfindung der Töpferscheibe konnten in der Altpalastzeit bereits diffizile Keramikgefäße hergestellt werden, dabei wurde der sog. „Kamáres-Stil“ kreiert - auf den schwarzen Untergrund von Gefäßen und Vasen wurden mit weißer und roter Farbe die vielfältigsten Muster und Formen gemalt. Dieser Stil gilt als der schönste des vorgeschichtlichen Griechenlands, benannt ist er nach einer Höhle am Südhang des Psilorítis, wo man die größte Menge der schwarzgrundigen Keramik entdeckt hat.
Weiterhin gibt es hier prächtige Schnabelkannen, hauchdünnen Goldschmuck, Schwerter, Siegelsteine, große Amphoren und Vasen, zahllose kleine Keramikfiguren und -tiere sowie Kultfigürchen (Idole) aus Marmor, Alabaster und Elfenbein.
Читать дальше