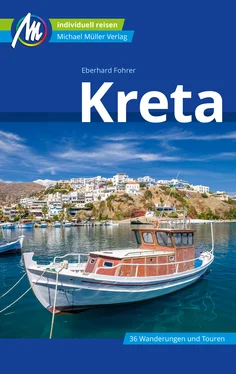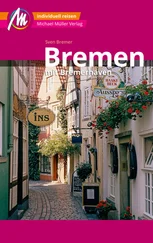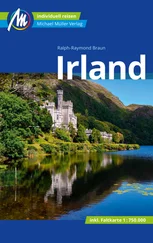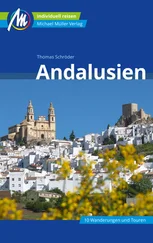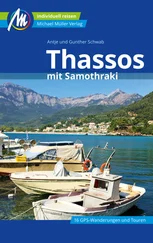Nachpalastzeit (1450-1300 v. Chr.), Saal 9 bis 12: Die Nachpalastzeit war die Spätzeit des Palastes von Knossós, denn als einziger der großen Paläste wurde er nach der rätselhaften Katastrophe von 1450 noch einmal bewohnt, und zwar von mykenischen Einwanderern. Die minoische Kultur war jedoch im Niedergang. Es wurden einfachere Materialien verwendet, Schematisierungen häuften sich, die gröbere mykenische Kunst überdeckte oder kopierte die ehemalige Originalität. Zu sehen sind u. a. Schrifttafeln, Grabpithoi, Grabbeigaben, Helme und Schwerter, Vasen und Schmuck, auch ein paar minoische Stücke haben sich hierher verirrt. Ein Höhepunkt sind die Sarkophage in Saal 12.
Saal 10 Der prächtige Lederhelm mit aufgenähten Eberzähnen ist ein typisch mykenisches Stück. (Vitrine 105), anmutig und höchst künstlerisch ist die Alabastervase in Form einer Tritonmuschel (Vitrine 109).
Der Sarkophag von Agía Triáda
Der bedeutendste aller Sarkophage in Saal 12 ist von einer Glasvitrine umgeben. Er stammt etwa von 1400 v. Chr. und besteht aus Kalkstein, damit ist er der einzige Steinsarkophag, der je auf Kreta gefunden wurde. Er ist über und über bemalt, wobei die Fresken besonders gut erhalten sind. An den beiden Längsseiten sind kultische Handlungen dargestellt. Auf der einen ein Stieropfer - das Tier liegt gefesselt auf einem Altar, darunter zwei weitere Opfertiere, dahinter ein Flöte spielender Musikant, rechts wäscht sich eine Priesterin die Hände. Auf der anderen Seite links Priesterinnen - eine hat eine Tragestange mit Körben auf der Schulter, die andere gießt das Blut des geopferten Stieres in ein Gefäß zwischen Doppeläxten. Rechts bringen drei Männer dem Toten, der vor seinem Grab steht, Kälber und ein Schiff.

Saal 11 Große Kultidole aus Ton mit zylindrischen Röcken, hoch erhobenen Händen und eigenartigem Kopfschmuck mit Mohnkapseln, letztere wurden angeblich bei religiösen Ritualen als Stimulans verwendet (Vitrine 117).
Saal 12 Eine eindrucksvolle Reihe minoischer Tonsarkophage nimmt den Großteil des Raumes ein, gefunden wurden sie in mehreren Nekropolen. Die Minoer bestatteten darin ihre Toten mit auf der Brust gekreuzten Armen und angezogenen Beinen.
Archaische und klassische Zeit (900-400 v. Chr.), Saal 26 und 27: Die archaische Zeit (700-600 v. Chr.) ist vor allem durch ihre Monumentalkunst bekannt, originäres Kunstschaffen existierte damals auf Kreta nicht mehr. Ausgestellt sind auf Kreta gefundene Großskulpturen sowie Köpfe aus Marmor, sie stammen vor allem aus Górtys, der damaligen römischen Inselhauptstadt. Zu den Prunkstücken der Klassik gehört am Ende des Saales 27 die Skulpturengruppe Pluto und Persephone (Seraphis/Isis) mit dem dreiköpfigen Hund Cerberus, dem Wächter der Unterwelt.
Obergeschoss
Minoische Fresken, Korridor: Im breiten Korridor vor den Ausstellungssälen sind die Reste der farbenprächtigen Wandfresken zu sehen, die das Innere des Palastes von Knossós und verschiedener anderer Paläste und Villen schmückten. Sie stammen fast ausschließlich aus der Neupalastzeit (1700-1450 v. Chr.).

Im Korridor der Fresken
Streng genommen muss man eigentlich von Wandmalereien und nicht von Fresken sprechen. Die Minoer pinselten ihre Farben nämlich nicht auf den noch feuchten Wandverputz (al fresco - ital. = im Feuchten), wie es für echte Freskenmalerei notwendig ist, sondern auf den bereits trockenen Gipsbelag. Während sich „al fresco“-Malerei, die vor allem die italienischen Renaissancekünstler meisterhaft einsetzten, untrennbar mit dem Grund verbindet und für Jahrtausende dauerhaft konserviert ist, blätterten die minoischen Gemälde bald ab. So blieben nur karge Reste der teilweise überlebensgroßen Darstellungen erhalten. Schon im Auftrag des Entdeckers Sir Arthur Evans (→ Knossós) ging der Schweizer Künstler Gillieron Anfang des 20. Jh. in mühsamer Kleinarbeit daran, die ehemaligen Gesamtkompositionen der Wandbilder zu rekonstruieren. Mit großer Akribie erschloss er aus den spärlichen Originalfragmenten die ursprünglichen, großflächigen Wandgemälde. Dem heutigen Betrachter scheint es kaum mehr vorstellbar, wie man aus den oft nur handtellergroßen Stücken meterhohe Figuren herleiten kann. Doch Gillieron konnte aus dem Vergleich des gesamten erhaltenen Materials gewisse, immer wiederkehrende Regelmäßigkeiten ableiten, die für alle Bilder zutrafen und so die fehlenden Teile schlüssig ersetzen. Allerdings wird mittlerweile in der Forschung vieles davon in Frage gestellt - vor allem der „Prinz mit den Lilien“ entstammte wohl mehr der Fantasie von Evans, denn er setzte die Gestalt des Priesterkönigs aus Teilen mehrerer Bilder zusammen. Immerhin soll die betörende Farbenpracht der Fresken authentisch sein. Auf den Originalstücken ist davon allerdings nur noch ein schwacher Abglanz zu entdecken - die rekonstruierten Teile überstrahlen sie bei weitem.
Thematisch sind hauptsächlich Naturszenen und Kulthandlungen dargestellt, Männer sind meist rot gemalt, Frauen haben weiße Haut. Üppiger Naturalismus, Freude an Farbe und Fantasie kennzeichnen die Bilder - ein auffallender Gegensatz zu den streng stilisierten Fresken der Ägypter, von denen die Minoer diese Technik angeblich übernommen haben.
An der Nordwand sieht man Fragmente des Prozessionskorridors aus Knossós. Im Original sollen es 500 (!) Figuren gewesen sein, die sich in langen Reihen auf die zentral gemalte Prinzessin oder Göttin zubewegten. Sie halten Gefäße in der Hand, am Ende steht der bekannte Rhytonträger, von ihm ist sogar der Kopf erhalten.
An der gegenüberliegenden Wand trägt der sog. Prinz mit den Lilien einen Lendenschurz und einen Kopfschmuck aus Lilien. Mit der Hand zieht er ein nicht erhaltenes Wesen hinter sich her, vielleicht einen sog. Greif, der die Macht des Mínos verkörperte (→ Link). Es wird spekuliert, dass es sich dabei um den Priesterkönig von Knossós handeln könnte, doch die Darstellung des Prinzen wird von der Wissenschaft stark in Frage gestellt. Die Lilienkrone, die Evans ihm aufs Haupt setzte, stammt z. B. wohl von einer Göttin oder Sphinx.
An derselben Wand hängt das wunderbare Fresko Drei Blaue Damen.
Die kleine Pariserin aus dem Piano Nobile in Knossós ist eins der berühmtesten Fresken des Palastes. Es stellt eine Priesterin dar, wie man an dem kultischen Knoten im Haar erkennt. Die Ausgräber sahen aber in ihr eine junge attraktive Frau, die sie sich am besten in Paris, dem damaligen Zentrum von Eleganz und Mode, vorstellen konnten.
Griechisch-römische Abteilung, Saal 14 bis 25: Die umfangreiche Sammlung umfasst Stücke von der geometrischen über die archaische bis zur klassischen, hellenistischen und römischen Epoche (10.-1. Jh. v. Chr.). In der geometrischen Epoche (900-650 v. Chr.) verschmolzen minoische, griechische und orientalische Einflüsse miteinander, eine eigentlich kretische Kunst gab es nicht mehr. Die Keramik war wuchtiger und strenger als bei den Minoern, teilweise abgemildert durch die verspielten orientalischen Motive.
Читать дальше