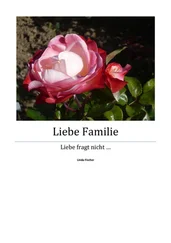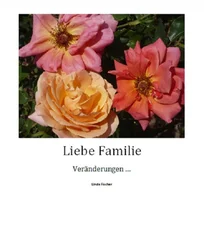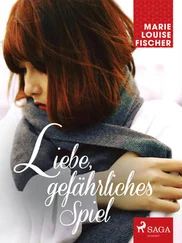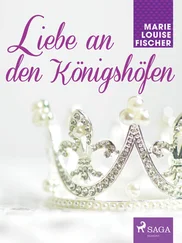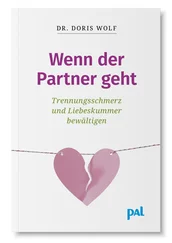Wichtig ist auch, sich über den konkreten Tagesablauf in angemessenen Intervallen gegenseitig „upzudaten“ – nämlich immer dann, wenn sich etwas im normalen Ablauf der Dinge verändert hat. Damit das Miteinander so reibungslos wie möglich funktioniert (Probleme von außen tauchen ja trotzdem verlässlich auf), muss man miteinander reden. Sieht man sich tagsüber kaum, weil jeder in seinem Büro sitzt, hilft ein Familienplaner, in den alle anstehenden Termine gut sichtbar eingetragen werden, oder am Kühlschrank befestigte Notizen – Kommunikation kann auch schriftlich erfolgen. Hauptsache, sie funktioniert.
Wie sieht gute Paarkommunikation aus?
Die erste Hürde, die genommen werden muss, ist, trotz scheinbaren Zeitmangels Gelegenheiten zum Gespräch zu finden. In unserem hektischen Alltag findet Kommunikation oft nur noch zwischen Tür und Angel statt und beschränkt sich auf Alltagsthemen: was man kochen wird, wer mit dem Staubsaugen dran ist, wann die Kinder abgeholt werden müssen und welchen Sender man sich am Abend gönnt. Das alles hat mit echter Paarkommunikation sehr wenig zu tun.
Paarkommunikation braucht Zeit und Ruhe, damit man zu jenen Themen vordringen kann, die mit unseren tieferen Wünschen und Erwartungen, mit unserem innersten Wesen und unseren Gefühlen zusammenhängen. Um sich diesbezüglich öffnen zu können, sollten Freiräume geplant werden, in denen beide Partner sich Zeit füreinander nehmen; denn wenn nur der eine das Bedürfnis hat, zu reden, während dem anderen der Kopf vor unerledigten Aufgaben schwirrt, wird es keine echte Kommunikation geben – weil es unter diesen Umständen unmöglich ist, richtig zuzuhören. Dann gibt man ein mechanisch Hingesagtes „Ja, klar!“ von sich oder murmelt ein „Hmmm, seh ich genauso“, ohne sich auf das Gesagte konzentriert zu haben. Das führt logischerweise zu Konflikten, denn man weiß oft nach einer Woche nicht mehr, wozu man seinen Sanctus gegeben hat. Fokussierung auf den anderen bedeutet interessiertes Zuhören, physische Zugewandtheit, Blickkontakt, unvoreingenommenes Nachfragen und positive Rückmeldungen zum Gesagten.
Paarkommunikation bedeutet auch, dass man seine frustrierenden Erlebnisse dem Partner mitteilen kann und so Erleichterung erfährt – nicht unbedingt dadurch, dass sich mithilfe des Gegenübers eine Lösung ergibt, sondern weil schon das Mitfühlen des Partners einem hilft, dem Unangenehmen gestärkt gegenüberzutreten. „Geteiltes Leid ist halbes Leid“ weiß der Volksmund – andererseits gilt natürlich auch „Geteilte Freude ist doppelte Freude“. In den Gesprächen eines Paares sollte immer auch Platz für die schönen Dinge des Lebens sein, die man erlebt hat oder die man sich gemeinsam für die Zukunft ausmalt.
Auch Probleme zwischen den Partnern müssen – nachdem sie erkannt wurden – besprochen werden, damit gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden kann. Wer aus falsch verstandener „selbstloser“ Liebe – die es nur in einem Fall gibt: die Liebe der Eltern zu ihren Kindern – seine Probleme, die er mit dem Partner hat, einfach unter den Teppich kehrt, wird merken, dass sie immer größer werden und die Beziehung immer mehr gefährden.
Ein Beispiel: Ingrid wünscht sich schon lange, wieder einmal mit ihrem Mann auszugehen. Norbert hat seinen wöchentlichen Herrenabend und geht sonntags mit seinen Freunden zum Sport. Immer wieder erwähnt Ingrid, wie schön es doch wäre, einen Abend mit Freunden zu verbringen (obwohl ihr das nicht leicht fällt – lieber wäre ihr, er würde von selbst mit der Idee antanzen). Norbert kann der Aussicht auf einen gemeinsamen Abend durchaus etwas abgewinnen und meint treuherzig: „Ja, fein, machen wir das doch nächstes Wochenende!“ Er nimmt es sich in diesem Moment vielleicht auch wirklich vor; am nächsten Samstag ist er aber nach dem Herrenabend und vor dem sportlichen Treffen eher der häuslichen Couch zugeneigt – sein Versprechen scheint er vergessen zu haben. Norbert hat Ingrids Wunsch nach einem Tapetenwechsel nicht verstanden. Oder er will es nicht verstehen. Woche für Woche wiederholt sich das – Ingrid sagt aber irgendwann nichts mehr. Obwohl ihre Bedürfnisse offensichtlich ignoriert werden, glaubt sie, mit ihrem Mann nachsichtig sein zu müssen („Der Arme arbeitet so viel – da muss er sich ja entspannen können!“). Obwohl sie sich in dieser Beziehung schon länger nicht mehr wohlfühlt, ändert sich nichts. Helfen würde nur eines: dass Ingrid ihren Wunsch nachdrücklich äußert und seine Erfüllung einfordert. Aber nicht nur darauf wartet, dass Norbert mitmacht: Ingrid kann Freunde einladen oder treffen – unabhängig von ihrem Mann.
Bei Streitthemen ist die Gefahr natürlich besonders groß, dass die Kommunikationsbereitschaft irgendwann an ihre Grenzen kommt und das gemeinsame Gespräch gar nicht mehr möglich ist, weil ein Partner sich zurückzieht oder auf aggressivere Art und Weise zeigt, dass er das Gespräch nicht fortsetzen möchte (Telefonhörer auflegen, Türe zuknallen und gehen etc.). Das lässt sich vermeiden, wenn man sich in konstruktiver Streitkultur übt: Der Sprecher sollte beispielsweise das, worüber er sich beklagen will, als Ich- und nicht als Du-Botschaft äußern – dann werden die Wellen nicht so hoch schlagen. Ich-Botschaften („Ich finde dieses Verhalten von dir nicht in Ordnung!“) drücken persönliche Gefühle aus, Du-Botschaften („Du hast schon wieder dieses oder jenes getan!“) werden stets als Anschuldigung bzw. Anklage verstanden und zwingen den Partner, sich zu rechtfertigen und zu verteidigen. Es ist wichtig, dass der andere sein Verhalten erklären kann, sich aber nicht rechtfertigen muss. Also statt eines vorwurfsvollen „Warum kommst du schon wieder so spät?“ lieber ein neutraleres „Jetzt hab ich aber sehr lange gewartet!“ aussprechen. Dann fliegen dem Partner nicht die Vorwurfsgeschosse um die Ohren, und er kann sein Zuspätkommen in Ruhe erklären: „Es gab leider einen riesigen Stau nach einem Unfall, und ich hatte keine Handyverbindung!“
Auch bei größeren Entscheidungen ist es wichtig, dass man richtig miteinander kommuniziert. Man sollte dem Partner immer signalisieren, am eigenen Beitrag zu einer gemeinsamen Lösung interessiert zu sein. Wenn man ihm oder ihr beispielsweise kategorisch eröffnet: „In dieses Zimmer passt nur Beige!“, ist der Partner von Vornherein vom gemeinsamen Suchen und Finden ausgeschlossen. Wenn man stattdessen so formuliert: „Meinem Geschmack nach passt nur Beige in dieses Zimmer, was sagst du dazu?“, hat das Gegenüber automatisch das Gefühl, mitreden zu dürfen, ernst genommen zu werden und wichtig für seinen Partner zu sein.
No-Go’s in der Paarkommunikation
Negative Pauschalisierungen und VerallgemeinerungenStatt den Partner mit Sätzen wie „Immer kommst du zu spät!“, „Nie fragst du mich, was ich mal gerne hätte!“ oder „Wie kann man nur so schlampig sein!“ anzugreifen, sollte das störende Verhalten ganz konkret benannt werden. Die Verallgemeinerungen stimmen ja meistens nicht; die Aussagen bedeuten lediglich, dass der Partner dieses Verhalten sehr oft an den Tag legt. Weniger kränkend für ihn oder sie ist eine Aussage wie „Ich möchte, dass du mich in Zukunft nicht mehr warten lässt!“, „Ich brauche unbedingt einen kinderfreien Abend pro Woche – könntest du das irgendwie einrichten?“ oder „Deine herumliegenden Socken stören mich enorm!“ Es ist immer besser, Frust und Enttäuschung, egal, wie groß sie sind, so zum Ausdruck zu bringen, dass der andere sich nicht in seiner Persönlichkeit angegriffen fühlt, sondern versteht, dass es um ein konkretes negatives Verhalten geht.
Herablassende BemerkungenÄußert der Partner seine Probleme, sollte man Mitgefühl zeigen und ihn keinesfalls mit Kommentaren wie „Immer musst du herumjammern!“ oder „Dir kann man es einfach nicht recht machen!“ kränken. Das sind herablassende Äußerungen bzw. Charakterzuschreibungen, die nur eines bewirken: dass sich der Partner oder die Partnerin immer mehr zurückzieht. Studien haben gezeigt, dass nach einer einzigen negativen Botschaft fünf positive Botschaften notwendig sind, damit das Gegenüber sich wieder im psychischen Gleichgewicht befindet. Es gibt kaum etwas Verheerenderes für eine Beziehung als eine Kommunikation, in der es an Wertschätzung und Achtung für den anderen fehlt.
Читать дальше