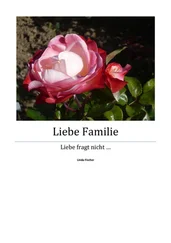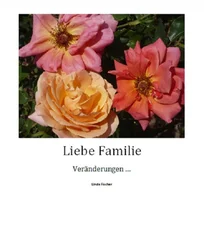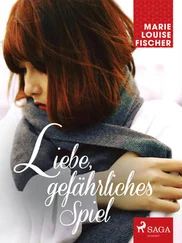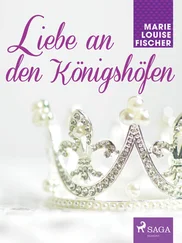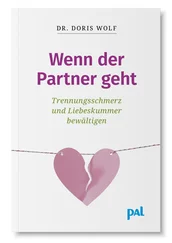Sollen wir nun Reißaus nehmen? Mitnichten, denn das alles ist völlig normal! Wir sind von Wolke sieben heruntergepurzelt und unsanft in der Realität gelandet. Und jetzt? Dranbleiben! Der Crash war notwendig, denn nur so kommen wir auf den richtigen Weg: Partnerschaft heißt ja nicht, sich für den anderen aufzugeben. Partnerschaft bedeutet, zu sich selbst und seinen Bedürfnissen zu stehen und das ebenso dem Partner zuzugestehen. Allerdings sind gewisse Voraussetzungen notwendig, wenn eine Beziehung über längere Zeit halten soll.
Was braucht Partnerschaft?
Rufen wir uns noch einmal unsere vereinfachte Formel in Erinnerung: Partnerschaft = Freundschaft + Erotik. Erotik gibt es am Anfang der Beziehung zuhauf; wenn sich dann im Alltag die Interessenskollisionen der Partner häufen und es immer schwieriger wird, Kompromisse zu finden, steht das Ganze erst einmal auf dem Prüfstand. Genauso wichtig wie die erotische Anziehung sind nun die kommunikativen Fähigkeiten sowie die Bereitschaft beider Partner, Belastungen zu ertragen und auf den anderen einzugehen. Wir sind eher gewillt, die Nachteile einer festen Beziehung zu akzeptieren, wenn wir uns bewusst für eine Partnerschaft entschieden haben. Dann fällt es uns nämlich viel leichter, die notwendigen Bedingungen zu schaffen, die das Überleben der Beziehung sichern:
Partnerschaft braucht vor allem die Fähigkeit und den Willen der Partner, Intimität und Nähe zuzulassen – jene Nähe, von der wir in der Phase der Verliebtheit nicht genug kriegen konnten und die uns im Alltag oft abhandenkommt. Wir sollten immer bereit sein, uns auszutauschen, uns dem anderen gegenüber zu öffnen, ihm zu vertrauen und Interesse an ihm und seinen Bedürfnissen zu zeigen. Da wir meistens keine Telepathen sind, die wissen, wo der andere emotional gerade steht, was er braucht und was er fühlt, heißt das: regelmäßig und oft miteinander reden. Wir müssen uns austauschen, um beim Gegenüber „up to date“ zu sein.
Genauso wichtig ist aber auch der gegenseitige Respekt, das Bedürfnis, dem anderen Gutes zu tun, die Erfahrung, dass man gemeinsam Schönes erleben kann. Dann fühlt man sich in der Beziehung wohl – was nicht heißen soll, dass der eine Partner zu 100 Prozent für das Wohlbefinden des anderen zuständig ist. Nicht umsonst heißt es: „Jeder ist seines Glückes Schmied.“ Gewisse Grundbedingungen sollte der Partner aber schon miterschaffen. Wenn beide „aufeinander schauen“, umso besser.
Partnerschaft bedeutet auch, mit jenen Seiten des Partners zurechtzukommen, die einem gegen den Strich gehen. Den Partner können wir meistens nicht ändern (wir haben es ja mit einem erwachsenen, fertig geformten Menschen zu tun); also ist unsere Toleranz gefragt, damit wir ihn mitsamt seinen Schwächen akzeptieren und unsere Augen in Bezug auf seine Fehler immer wieder „zudrücken“ können. Genauso hilfreich ist es, sich selbst in seiner Unvollkommenheit zu sehen und zu erkennen, dass der Partner ja auch oft nachsichtig ist. Also sollte man den Hebel bei sich selbst ansetzen. Ändere ich mich selbst, verändert sich das Gegenüber meistens mit.
Wichtig sind auch die Gleichwertigkeit unter den Partnern sowie ähnliche Normen, Werte und Lebensziele. Abhängigkeit oder Dominanz erschwert eine Partnerschaft ungemein. Ein Ungleichgewicht zwischen den Partnern führt nicht selten zur Trennung. Begegnet ein Paar sich jedoch auf Augenhöhe, hat es die Möglichkeit, sich gemeinsam zu entwickeln und mit der Zeit „zusammenzuwachsen“. Dieser Prozess setzt jede Menge Freude und Energie frei. Schon Wolfgang Ambros wusste das: „Wir hab’n uns und wir hab’n uns gern … und langsam wochs’ ma z’amm.“
Diese notwendigen Bedingungen zu erschaffen, ist nicht immer leicht, aber auch nicht unmöglich. Jedenfalls obliegt es jenem Partner, der eine Änderung wünscht, seinen Wunsch dem anderen zu vermitteln. Schon als Kinder haben wir immer wieder zu hören bekommen: „Wenn du etwas willst oder brauchst, musst du es sagen!“ Prinzipiell hat sich das auch im Erwachsenenalter nicht geändert. Freilich: Nur weil etwas gesagt wird, heißt das noch lange nicht, dass es gehört wird, und schon gar nicht, dass dieses Bedürfnis auch erfüllt wird. Aber ohne Kommunikation gibt es auch keine Chance auf Änderung.
Kommunikation in der Partnerschaft
„Viele können argumentieren –
wenige ein Gespräch führen.“
Amos Bronson Alcott
Wie vermittelt man dem Partner Wünsche und Bedürfnisse?
Indem man sich klar und deutlich äußert. Wir könnten theoretisch auch schweigen und hoffen, dass der Partner uns aus lauter Liebe unsere geheimsten Wünsche und Erwartungen von den Augen abliest; aber diesem romantischen Klischee entsprechen die wenigsten Menschen. Wir sind zwar durch unsere sogenannten „Spiegelzellen“ empathiefähig, können uns also bis zu einem gewissen Grad in den anderen hineinversetzen; mit Sicherheit sind wir aber unfähig, Gedanken zu lesen. Warum also nicht gleich sagen, was man gern hätte? Wir sind keine kleinen Kinder mehr, die auf Eltern angewiesen sind, die gut im Erraten ihrer Bedürfnisse sind. Wir sind Erwachsene, denen die menschliche Sprache zur Verfügung steht und die sie in ihrer ganzen Vielfalt nützen können. Dabei sollten wir uns vor Augen halten, dass jede Äußerung gleichzeitig auf drei Ebenen stattfindet:
Auf der verbalen Ebene (das ist der Sinngehalt der Wörter in einem Satz). Hier ist die Aussage „Fein, deine Mutter kommt also über die Feiertage zu Besuch!“ vorerst einmal eine neutrale Antwort auf die Ankündigung des Besuchs der Schwiegermutter.
Auf der nonverbalen Ebene (auf der Mimik und Gestik eine Rolle spielen). Hier hat derselbe Satz zwei Bedeutungen, je nachdem, ob man ein fröhliches Gesicht dazu macht oder ob man mit den Augen rollt und das Gesicht verzieht: Ist die Mimik optimistisch, freut man sich ehrlich über den Besuch. Hängen die Mundwinkel eher herab, hat man sich Weihnachten anders vorgestellt, aber: a) Man zeigt sich trotzdem entgegenkommend – es wird also trotz allem harmonisch verlaufen – oder b) Man ist wütend und nimmt eine vorwurfsvolle Haltung an, was eher Streit und ungute Stimmung bedeutet. Was davon der Fall ist, zeigt sich auf der dritten Ebene:
Auf der paraverbalen Ebene (hier ist die Stimmlage ausschlaggebend für die Bedeutung des Satzes in all seinen Konsequenzen). Ist der Tonfall herablassend oder wütend, bedeutet der Satz genau sein Gegenteil („Es ist überhaupt nicht fein, dass deine Mutter zu Besuch kommt!“) und der Haussegen hängt schief. Bei unsicherer Stimme und freudlosem Gesichtsausdruck macht sich das Gegenüber lediglich Gedanken, wie man das Weihnachtstreffen gut überstehen könnte, da die Schwiegermutter so ihre Macken hat. Ist die Stimme unsicher und die Mimik eher ängstlich, geht man davon aus, dass es schwierig sein wird, eine schöne Zeit mit dem Gast zu verbringen, dass man sich aber trotzdem bemühen wird, das Beste daraus zu machen.
In jedem Satz, den wir äußern, steckt also eine Menge Interpretationsspielraum. Dabei gilt: „Der Ton macht die Musik.“ Wie wir etwas sagen, ist genauso wichtig wie der Inhalt unserer Äußerungen. Wir haben sicher mehr Erfolg mit einer freundlich geäußerten Bitte als mit einem weinerlichen Vorwurf. So gesehen liegt es eigentlich in unserer Macht, mit der Äußerung unserer Wünsche beim Partner erfolgreich zu sein. Theoretisch – denn in der Praxis sind wir nicht alle Meister der Rede: Der eine spricht weniger bedacht als der andere, weil er sich leichter von Emotionen aus der Fassung bringen lässt und so seinen „Verhandlungserfolg“ auch weniger steuern kann. Dem anderen fehlt es schlicht und einfach an Worten. Ist man sich seiner rhetorischen Mängel jedoch bewusst, kann man durch bewusste Pausen beim Sprechen, die einem Zeit zum Überlegen lassen, viel kompensieren.
Читать дальше