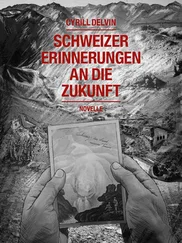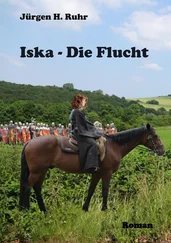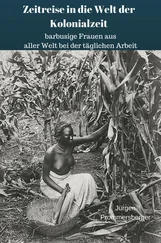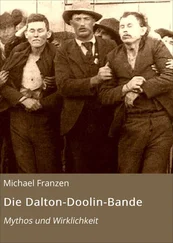Als der Ostblock zusammenbrach, ergriffen Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher nach Zögern den „Mantel der Geschichte“ und setzten auf die deutsche Einheit. Der Wunsch nach der Einheit des Nationalstaates gehörte zu den Wertvorstellungen älterer Politiker wie auch Willy Brandt oder Richard von Weizsäcker. In der westdeutschen Bevölkerung war die nationale Einheit besonders bei den Jüngeren kein relevanter Wert, und entsprechend agierten der Kanzlerkandidat der SPD von 1990, Oskar Lafontaine, und die „Grünen“. Aber Kohl und Genscher setzten auf die deutsche Einheit. Sie erhielten die Unterstützung einer Mehrheit der Ostdeutschen sowie ihrer Generationsgenossen in Westdeutschland.
Bei der Einheit stießen zwei politische Kulturen in Deutschland aufeinander. Wie hätte es anders sein sollen, nachdem die politische Sozialisation in Ost und West unterschiedlich verlaufen war? Wurden im Westen Individualismus bis hin zum Egoismus, Leistung und Durchsetzungsfähigkeit als grundlegende Werte vermittelt, so waren es im Osten die Werte Gemeinschaft, Solidarität und soziale Sicherheit. War vom Westen aus trotz aller Antiamerikanismen New York der Mittelpunkt der Welt, so war es vom Osten her Moskau. Der Osten sollte sich an den Westen anpassen. Das führte zu unterschiedlichen Verarbeitungsprozessen. Die Systemkritiker im Untergang des Staatskommunismus verabsolutierten ihre in der Wende gemachten Erfahrungen und waren danach für westliche Verhältnisse ungewohnt rigoros und unerbittlich in der Verurteilung des alten Systems. Die Verlierer und die sich missverstanden Fühlenden aus dem alten System wollten ihre eigene Identität „einbringen“ und machten die PDS stark. Die meist bei den „Grünen“ gelandeten Rigoristen aus dem Osten wie die von „Bündnis 90“ und eben die PDS waren neue Elemente im Parteiensystem.
Entgegen der Erwartungen von 1990 passte sich der Osten nicht an den Wohlstand des Westens an, sondern der Westen büßte ebenfalls Arbeitsplätze ein. Die ökonomische Schere zwischen Ost und West schloss sich nicht, sondern öffnete sich weiter. Das ist die Hauptursache dafür, dass sich ein ostdeutsches Milieu hielt, gehegt von der PDS – später den „Linken“ –, die bei Landtagswahlen davon profitierte. 2005, nachdem die rot-grüne Bundesregierung – möglicherweise handwerklich unzulänglich – eine Reform des Sozialstaates gewagt hatte, schwappte die Verunsicherung darüber in den Westen.
Wenn auch die rot-grüne Koalition 2005 jäh endete, so hatte sich doch in deren Zeit einiges an der politischen Kultur in Deutschland geändert:
Die Einbürgerung länger in Deutschland lebender Ausländer wurde erleichtert; die Zuwanderung weiterer allerdings erschwert. Was die offizielle Politik bislang ignoriert hatte, galt nun als Tatsache: Deutschland wurde ein Einbürgerungsland.
Das Monopol der Ehe zwischen Mann und Frau als Basis der Gesellschaft wurde gebrochen; gleichgeschlechtliche „Ehen“ wurden möglich.
Der absolute Wert der Familie wurde aufgehoben, temporäre Beziehungen und „Singlehaushalte“ wurden der Ehe gleichgesetzt.
Die absolute Fortschrittsgläubigkeit im Hinblick auf neue Technologien wurde konterkariert durch den eingeleiteten Ausstieg aus der Atomenergie und durch die von den „Grünen“ eröffnete Debatte über die Grenzen der Gen- und Zellentechnologie.
Das Gebot der trotz aller Antiamerikanismen in der Bevölkerung bis dahin gepflegten diplomatischen Rücksichtnahme auf die Interessen der Führungsmacht USA wurde im Bunde mit Frankreich und Russland bei den Entscheidungen über den Irakkrieg gebrochen. Die deutsche Abnabelung von den USA-Interessen hielt an – verstärkt durch die antideutsche Einstellung des früheren US-Präsidenten Trump.
Der Anspruch, die Menschenrechte als einen Maßstab der deutschen Außenpolitik zu nehmen, wurde wie im Falle Tschetschenien gegenüber Russland aber auch Guantanamo gegenüber den USA und generell gegenüber China fallen gelassen: Wirtschaftsinteressen wurden über moralische Ansprüche gestellt.
Die Einordnung deutscher Politik hinter die Ziele der Europäischen Union wurde – zumindest zeitweise – aufgegeben wie die mehrfachen Nichtachtungen vereinbarter Defizitkriterien beim Haushalt gezeigt hatten.
Deutschland definierte sich als „größere Mittelmacht“, die eigene Interessen auch ohne Rücksicht auf traditionelle Verbündete durchsetzte.
Der Begriff „Reform“ wurde umgedeutet: Rot-Grün wagte unter der Überschrift „Hartz I – IV“ ein Abspecken des Sozialstaates wie ihn Schwarz-Gelb nicht geschafft hatte mit der Folge, dass die SPD ein Defizit bei ihrem Leitthema „soziale Gerechtigkeit“ hatte.
Angela Merkel hingegen, die spätere langjährige Bundeskanzlerin von der CDU, lebte von den Früchten dieser „Reform“.
Gegen den Druck nach politischer Korrektheit gab es gelegentliches Aufbegehren. Insbesondere die von „Grünen“, aber auch von der SPD favorisierte „Multikulturelle Gesellschaft“ forderte vor allem Konservative heraus. Sie sprachen von der Notwendigkeit einer „deutschen Leitkultur“, was wiederum Protest rot-grüner Aktivisten hervorrief.
Dann kamen als Folge des 11. September 2001 – dem Tag der Flugzeugentführungen ins New Yorker World Trade Center – Verdächtigungen gegen undurchschaubare muslimische Gruppen auf. Diese wären oft Brutstellen des Terrors. Das Attentat auf einen Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz bestätigte für viele diesen Verdacht.
Schließlich kam der Begriff von „Parallelgesellschaften“ auf. Hiermit waren zunächst türkische Kreise gemeint, die jenseits der deutschen Kultur und Sprache existierten, sich durch Frauenzuzüge aus Anatolien rekrutierten und in denen es sogar zu „Ehrenmorden“ an Frauen gekommen wären, die sich in Deutschland integriert hatten und sich den Wertvorstelllungen der Herkunftsfamilie entzögen.
Später wurden „arabische Clans“ aufgedeckt, denen organisierte Kriminalität vorgeworfen wurde.
Nach dem Ende von „Rot-Grün“ folgte eine lange Periode der Vorherrschaft von CDU und CSU in Deutschland unter der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die erste Frau an der Spitze einer Bundesregierung kam aus dem Osten und dort aus dem evangelischen Milieu. Diese Frau entzog sich bald dem altbekannten Bild einer CDU-Politikerin. Hinter ihr lag weder eine „Ochsentour“ in der Jugendorganisation JU 19noch eine in der Partei selbst.
Ganz Deutschland rätselte anfangs, wie es Angela Merkel möglich war, an der Macht zu bleiben. Sie hatte die CDU, diese Schlangengrube, umgestülpt – personell und inhaltlich. Kohl, Merz, Stoiber, Koch, Oettinger, Beust, Guttenberg und viele andere waren bald nicht mehr im Zentrum der Macht. In der großen Koalition hatte sich die Partei geräuschlos sozialdemokratisiert und war bald die stärkste Atomausstiegskraft der Republik. Die SPD kam an die Union nicht mehr heran, und die im Herbst 2009 noch übermütige FDP war zum trostlosen Haufen geworden.
Oft wurde das politische Ende Angela Merkels prophezeit, und stets lebte sie fort. Ihr Vorgänger Gerhard Schröder fing damit an, indem er weissagte, sie werde es nicht schaffen. Die Herren vom „JU – Andenpakt“ warteten auf den richtigen Moment, um „Mutti“ – wie sie ihre Vorsitzende tauften – aus dem Amt zu putschen. Selbst der loyale Sozialdemokrat Peter Struck bekannte einst: „Die kann mich mal.“
Heute sind sie alle in Pension oder weggelobt: der Altkanzler Schröder, die einst so stolzen CDU-Ministerpräsidenten und auch der einstige SPD-Fraktionsvorsitzende. Dessen Nachfolgerin Andrea Nahles hat ebenfalls resigniert, Friedrich Merz verlor mehrere Abstimmungen beim CDU-Bundesparteitag, und Peter Struck und Guido Westerwelle sind nicht mehr auf dieser Welt. Angela Merkel hingegen ist weiterhin Bundeskanzlerin.
Читать дальше