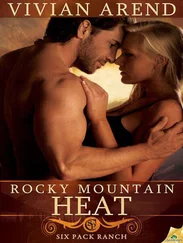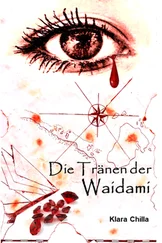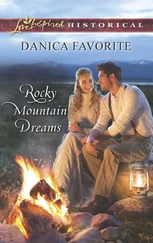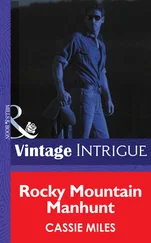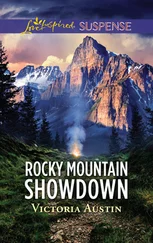Nach dem Essen fand sich Gelegenheit zu plaudern. Den Tag über hielt sie die anstrengende Arbeit in Atem, doch jetzt wurde erzählt und gelacht. Dave kam nicht dazu, über sein Weggehen nachzudenken, denn schon bald übermannte ihn der Schlaf. Er kuschelte sich in seine Decke und war wenige Minuten später eingeschlafen.
Der Tagesverlauf änderte sich so wenig wie die Landschaft. Die Prärie präsentierte lange Zeit das gleiche Bild: eine weite, offene Fläche, auf der jetzt – Anfang April – das Gras zu sprießen begann. Oft unterbrach nur eine Schar Krähen diese Monotonie, die schimpfend über sie hinweg flog, oder eine Herde Mustangs, die aufgeschreckt davongaloppierte und in die Weite des Landes entkam. Dafür zeigte sich der Missouri, den die Otoes zu Recht „den Großen Schlammigen” nannten, in abwechslungsreicher Vielfalt. Mal war sein Wasser ruhig, dann wieder wild und unberechenbar; jetzt war er über eine Meile breit und eine Stunde später zwängte er sich durch eine
wenige hundert Yards enge Schleuse, die steil aufragte und dessen Felsformation in den herrlichsten Schattierungen von Ocker über Zinnober bis zu hellem Blau in der Sonne leuchtete.
Am 4. April, dem zweiten Tag ihrer Reise, war Daves neunzehnter Geburtstag. Zum ersten Mal dachte er an daheim. Seine Mutter – jung und schön lächelte sie ihn an –, Mr und Mrs Blackmore und Cuthbert erschienen ihm in Gedanken. Er dachte auch an Miriam, seine erste Liebe, und an Clarissa Upton, jene Frau, die er begehrt und verteufelt hatte. Viele Menschen aus St. Louis, Orte und Begebenheiten drängten sich in seine Erinnerung. Doch er vermisste niemanden und nichts. Nur der Diebstahl des Gewehrs belastete ihn manchmal. Dass er heute Geburtstag hatte, verschwieg Dave.
Am nächsten Tag kam kräftiger Wind auf. Bell ließ Segel setzen, und am Abend hatten sie fünfunddreißig Meilen zurückgelegt. Das war mehr als das Doppelte, was sie nur mit Rudern geschafft hätten.
Jeder Tag, jede Meile brachte sie weiter westwärts. Jenem Land entgegen, in dem Dave die Freiheit zu finden hoffte.
Doch der Wind hielt nicht lange an. Wieder waren sie auf ihre Muskelkraft angewiesen. Die Schwielen an den Händen, die Dave die ersten Tage bekommen hatte und die ihm Reed mit Fett einrieb, waren zu fester Hornhaut verwachsen, die wie hartes Leder schützte. Glaubte Dave nun, die anstrengendste Tätigkeit leicht schaffen zu können, nachdem sich Muskeln und Hände dem Rudern angepasst hatten, so lernte er schon bald eine weitere Art kennen, die Boote fortzubewegen.
Ohne einen für Dave ersichtlichen Grund ließ Captain Bell am Ufer anlegen, das hier nur wenige Zoll höher als der Wasserspiegel war. Noch vor wenigen Wochen, als die Schneeschmelze die Flüsse gespeist hatte, musste das Land ringsum weitläufig überschwemmt gewesen sein. Noch immer war es feucht und nährte hohes, saftiges Gras. Eine Vielzahl von Vögeln lebte hier, und Myriaden von
Mücken summten in der Luft.
Der Grund, weshalb Bell hatte anlegen lassen, befand sich direkt vor ihnen. Für das ungeübte Auge unsichtbar, lauerte in dem schmutzig-gelben Fluss nur drei Fuß unter der Oberfläche eine Sandbank von mehreren Meilen Länge. Bell kannte diese und andere Hindernisse von seinen zahlreichen Reisen. Er brauchte nicht erst nachzumessen, um genau zu wissen, dass die beladenen Boote zu tief lagen. Sie
trugen deshalb die Fracht ans Ufer. Von dort marschierten sie los, jeder über einen Stirnriemen ein oder zwei Säcke tragend. Captain Bell, ein Hüne und Auswuchs an Kraft, schleppte zwei große Bündel, die zusammen an die zweihundertvierzig Pfund wogen. Dave schaffte immerhin zweihundert Pfund; und damit mehr als die meisten, was aber das Halbblut leistete, verlangte ihm den größten
Respekt ab.
Nach einer halben Meile legten sie ihre Last ab, liefen zurück und holten den nächsten Teil, bis die gesamte Fracht geholt war. Nach einer kurzen Pause gingen sie an die nächste halbe Meile. Etappe um Etappe schleppten sie die Fracht weiter. Nach der zweiten Meile fing das Land an, sumpfig zu werden. Die Männer sanken unter dem Gewicht auf ihren Rücken bis über die Knie in den Schlamm. Die Mücken quälten sie obendrein. Es war eine einzige Tortur, die sogar erfahrenen Männern wie Bell und Reed hart an die Grenze des Erträglichen ging. Graham Booker schlug wie wild nach den stechenden Quälgeistern und fluchte erbärmlich, was aber nur zur Folge hatte, dass sie ihn noch heftiger heimsuchten. Am Abend war sein Gesicht voller Pusteln und geschwollen. Die anderen sahen nicht hübscher aus.
Insgesamt dreieinhalb Meilen schleppten sie die Fracht. Dort wurde das Wasser wieder tiefer. Da es nun zu dunkel war, um die Boote zu holen, richteten sie sich ihr Lager. Schlafen aber konnte vorerst niemand, denn die Mücken folterten sie weiter. Schließlich vertrieb sie die Nachtkälte, und den Männern blieben fünf Stunden Ruhe. Schon vor Sonnenaufgang weckte sie Bell.
Sie treidelten die Boote. Während Durak, der Leichteste von ihnen, am Bug stand und mit dem Staken das Boot vom Ufer fern hielt,
zogen es die anderen mit einem langen Seil flussaufwärts. Ohne Fracht war der Tiefgang nicht nennenswert, das Boot glitt ohne Schwierigkeiten über die Sandbank hinweg.
Wieder mussten sie durch den Sumpf, und wieder kamen mit der Wärme die Mücken. Einen vollen Tag benötigten sie, um die zwei Boote in tiefes Wasser zu bringen.
Am dritten Tag um die Mittagszeit, als die Fracht an Bord war und sich die Boote langsam wieder in Bewegung setzten, sahen sie alle aus wie in Schlamm gebadet, obendrein waren ihre Hände und Gesichter feuerrot und juckten teuflisch.
Auch wenn diese Strapaze – Bell wusste, es warteten noch mehr solche Hindernisse auf sie – die Männer bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit geführt hatte, so war es doch für Tage die einzige Abwechslung gewesen. Auch die Prärie entschädigte sie nicht. Sie entfaltete jetzt ihre volle Schönheit, das Gras war saftig, Blumen blühten in tausenderlei Farben, Sträucher und einzelne Bäume zierten sie wie Tupfer auf einem herrlichen Teppich. Fast ständig war der Himmel sonnig. Der Duft von herb-süßem Salbei erfüllte das Land. Und nur die Stimmen des Präriehundes, das Zirpen der Grillen und manchmal der einsame Schrei eines Falken unterbrachen das ein-
tönige Klatschen der Ruder.
Henry Long Reed bemerkte bald, dass Dave etwas bedrückte. Eines Nachts, als sie sich in ihre Decken rollten, sprach er Dave darauf an.
„Ich hab gestohlen”, flüsterte Dave. Die anderen sollten es nicht
hören, Henry aber vertraute er. „Ich brauchte unbedingt ein Gewehr, deshalb nahm ich Mr Blackmores Büchse.”
Der Lange grunzte. Sein Gesicht war in der Dunkelheit verborgen, Dave konnte deshalb nicht erkennen, ob Reed ihn auslachte oder ob er ihn ernst nahm.
„Ich dachte, Mr Blackmore ist tot”, sagte Reed schließlich.
„Das ist er auch.”
„Dann versteh ich dich nicht. Einen Toten kann man doch nicht bestehlen. Ein Toter besitzt nichts.”
Nun grunzte Dave. Wenn man es so betrachtete, hatte er tatsächlich nichts Unrechtes getan. Aber es fiel ihm dennoch schwer, die Sache wie Reed auf die leichte Schulter zu nehmen. „Ich mache mir Vorwürfe. Aber ohne das Gewehr wäre ich jetzt nicht hier.”
„Dann wärst du noch in St. Louis”, flüsterte Reed nach einer Weile. „Das Gewehr hinge in Blackmores Haus, und nichts wäre anders als jetzt. Du hast wirklich niemandem einen Schaden zugefügt, Dave.”
Nicht so sehr Reeds Worte, sondern die Tatsache, dass der Lange uneingeschränkt auf seiner Seite stand, tröstete Dave etwas. Zwar dachte er noch manches Mal an sein Vergehen, doch mit der Zeit ebbte
sein schlechtes Gewissen ab und verblasste schließlich.
An diesem Abend aber schnitt Reed noch ein anderes Thema an, das Dave mindestens ebenso belastete wie der Diebstahl. Reed rechnete sich nämlich aus, wenn Dave das Gewehr gestohlen hatte, dann hatte er vorher also keines besessen. Und wenn er kein Gewehr besessen hatte, dann war es gut möglich, dass er mit einer Waffe nicht umgehen konnte. Frei heraus fragte er deshalb, aber so leise, dass es nur Dave verstehen sollte: „Du kannst doch schießen?”
Читать дальше