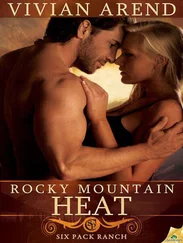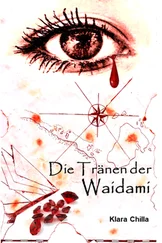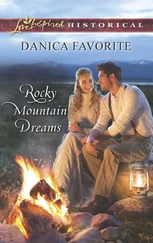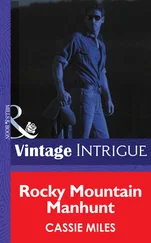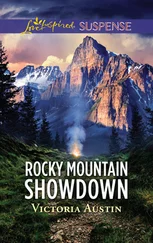Dave zögerte. Doch dann antwortete er ehrlich: „Ich kann nicht einmal ein Gewehr laden.”
Long Reed schwieg. Er grunzte nicht einmal. Er zog sich die Decke über den Kopf, und wenig später war von ihm nur noch pfeifendes Schnarchen zu hören.
Dave blieb noch lange wach. Er fragte sich, ob es ein Fehler gewesen war, Reed gegenüber zu beichten. Sollte der ihn bei Bell anschwärzen, standen Dave gewaltige Schwierigkeiten bevor. Der Captain verabscheute nichts mehr als Lügen. Für Männer, die mit Haut und Haaren aufeinander angewiesen waren, waren falsche Voraussetzungen so ziemlich das Schlimmste. Es konnte Dave durchaus
passieren, dass ihn Bell kurzerhand fortjagte. Doch Henry Long Reed hielt dicht.
Die folgenden Tage, wenn er und Dave nicht mit dem Rudern dran waren, setzten sie sich etwas abseits der anderen zusammen. Sie
taten dann, als reinigten sie ihre Gewehre oder als unterhielten sich über sonst was. Tatsächlich aber erklärte Reed ihm den Aufbau und die Funktionsweise der Waffe. Dave erfuhr, wozu das Zündhütchen und der Feuerstein waren und wie man aus einem Bleiklumpen mit Hilfe der Kugelzange gleichmäßige Kugeln machte.
„Das Laden ist das Wichtigste”, sagte Reed. „Nimm nicht zu viel und nicht zu wenig Pulver. Wenn du die Kugel in die flache Hand legst und sie mit Pulver so überhäufst, dass sie gerade nicht mehr zu
sehen ist, dann hast du die richtige Menge Pulver. Während der Jagd oder eines Kampfes wirst du aber oft keine Zeit finden, das Pulver auf deiner Hand zu messen. Entwickle deshalb so bald wie möglich ein Gefühl dafür. Auch die Durchschlagskraft sagt dir etwas über die richtige Menge. Wenn du die Kugel in den Leib einschlagen hörst, ist das ein sicheres Zeichen für zu wenig Pulver.”
Danach erklärte ihm Reed, wie das Pulver in den Lauf zu streuen, wie die Kugel einzuführen war und wie man mit dem Ladestock
beide feststampfte.
„Aber nicht zu fest, hörst du? Zwei- oder dreimal kurz anstoßen genügt.”
Die theoretischen Anweisungen, die Dave tagsüber erhielt, setzte er des Nachts, wenn er zur Wache eingeteilt war, in die Tat um. Anfangs war es schwer, im Dunkeln den Feuerstein zu wechseln oder das Gewehr zu laden. Sich nur auf den Tastsinn zu verlassen, war für Dave eine große Umstellung. Und manchmal, wenn er die Finger nicht richtig kontrollierte, entglitt ihm eine Kugel oder das Pulver landete im Gras anstatt im Lauf. Dann fluchte er leise, doch er probierte es immer wieder. So sehr er sich auch ärgerte, mit der Zeit entwickelte er eine geradezu schlafwandlerische Sicherheit. Zumindest, was das Laden und das Instandhalten der Waffe betraf.
Als ihm Reed schließlich noch erklärte, wie über Kimme und Korn zu zielen war, konnte Dave – theoretisch – schießen. Aber eben nur theoretisch. Die Praxis würde zeigen, wie weit er die Unterweisungen Reeds begriffen hatte. Dave wartete gespannt auf eine Gelegenheit, sein Wissen zu erproben. Niemand hatte von ihrer Schulung Wind bekommen. Dieses Geheimnis verband Dave und Long noch mehr. Sie wurden zu echten Freunden.
Drei Wochen, nachdem sie von St. Louis aufgebrochen waren,
sahen sie den ersten Indianer. Die Uferböschung stieg hier sanft an und verwehrte einen weiten Blick. Reed entdeckte den Indianer, der plötzlich auf dem Kamm der Böschung auftauchte, als Erster. Sein schwarzes Haar war lang und ungepflegt. Eine klobige Nase hing ihm schräg über dem schiefen Mund. Die Hässlichkeit seines Gesichts wurde noch betont durch den kurzen, fetten Leib, der in staubigen Leggins und einem schmucklosen dunklen Lederhemd
steckte. An Waffen trug er nur Pfeil und Bogen. Das Pferd war
schäbig; die Brustknochen traten deutlich unter dem Fell hervor, dem stellenweise die Haare fehlten. Schweif und Mähne bestanden nur noch aus ein paar Fransen, in die rot gefärbte Taubenfedern gebunden waren. Ohne ein Zeichen zu geben, folgte er den Booten in einer Entfernung von hundert Yards. Ob seine Stammesgenossen in der Nähe waren, ließ sich nicht erkennen.
Orlando Bell rief ihn mehrmals an, erhielt aber keine Antwort. Entweder verstand ihn der Indianer nicht, oder er wollte ihn nicht verstehen. Auch das mienenlose Gesicht ließ keine Reaktion auf die
Zurufe erkennen.
„Wenn er schon stumm ist wie ein Toter”, knurrte Graham Booker, „dann kann ich ihm auch gleich eins aufs Fell brennen.” Er nahm sein Gewehr, das immer geladen war, und legte an.
„Leg die Büchse hin, verdammter Idiot!”, befahl ihm Bell mit unterdrückter Stimme.
Booker gehorchte wortlos, aber er hätte liebend gern einen Schuss gewagt. Den Indianer schien das nicht zu stören. Stoisch ritt er neben ihnen her, sah weder nach links noch nach rechts. Manchmal schien es, als schlafe er beim Reiten. „Ist das ein Mandane?”, fragte Reed.
„Keine Ahnung”, sagte der Captain ruhig. „Das ist das Land der Mandanen. Er kann aber auch einem anderen Stamm angehören.”
„Was hat er vor?”
Bell zuckte die Schulter. „Weiß der Teufel.”
Ohne ersichtlichen Grund folgte ihnen der Indianer. Er kam aber nie näher als hundert Yards an den Fluss heran.
Für Dave war es der erste freie Indianer, den er zu Gesicht bekam. Die Caddos in ihren armseligen Behausungen vor St. Louis und der alte Medizinmann, der mehr oder weniger nur noch im Saloon
lebte, hatten in ihm ein verzerrtes Bild der Indianer entstehen lassen. Er ahnte wohl, dass dieses Bild nicht den Stämmen der Plains entsprach. Durch Reverend Gardner, der die wilden Indianer wie leibhaftige Teufel von der Kanzel aus verschrien hatte, aber auch durch die Frontier News, die fast regelmäßig von schrecklichen Überfällen auf friedliche Siedler berichtet hatte, war in Dave die Vorstellung gewachsen, der frei lebende Indianer sei groß und stark wie ein Bär, furchteinflößend wie ein zähnefletschender Wolf, voller Tatendrang und ständig unterwegs, um im tollkühnen Angriff wehrlose Menschen niederzumetzeln. Andere Berichte zeichneten ihn als einen stolzen, erhabenen Ritter der Prärie, der auf edlem Ross und mit wehendem Haar über die Ebene galoppierte.
Als Dave nun den seltsamen Begleiter betrachtete, wusste er, dass alles, was er über Indianer gelesen und gehört hatte, falsch war. Diese unscheinbare, unförmige Erscheinung auf dem dürren Gaul war weder stolz und erhaben zu nennen, noch schien sie tollkühn zu sein.
Dave tat es deshalb wie die anderen Männer auf den Booten: Sie beachteten den Indianer einfach nicht mehr. Mit kräftigen Armbewegungen hieben sie die Ruder ins Wasser, fluchten über die sengende Hitze, und Reed warf wieder seine Rute aus. Dem staunenden
Rätselraten folgte der nüchterne Arbeitsrhythmus.
Langsam wurde der Indianer zu einem Bestandteil der Umgebung. Wie ein Baum oder ein Strauch, nur dass er sich bewegte. Stur hielt er sich auf gleicher Höhe mit den Booten. Zwei Stunden vergingen, drei Stunden. Doch auf einmal schien ihn der Eskortierposten zu langweilen. Er riss sein Pferd hart am Zügel und galoppierte im nächsten Moment davon. Das Ufer war hier wieder flach, und sie sahen ihn in einer Geschwindigkeit über die Prärie dahinjagen, die sie dem
schäbigen Gaul nicht zugetraut hatten. Nur eine Minute später war von dem seltsamen Indianer nur noch eine Staubwolke in der Ferne zu sehen.
Dave und die anderen verschwendeten keinen Gedanken an den zeitweiligen Weggesellen. Doch als die Nacht kam, erinnerten sie sich wieder an ihn. Vorsichtshalber ließ Captain Bell die Wachen verdoppeln, da noch immer nicht sicher war, welchem Stamm der Indianer angehörte. Aber nur ein alter Wolf, der einsam umherstreifte, näherte sich dem Lager, ansonsten blieb es ruhig.
Am Morgen entdeckten sie südlich von sich eine Herde Gabelböcke. Sie waren aber zu weit entfernt, um auf sie zu schießen. Booker wollte unbedingt an Land, um eines dieser graziösen Tiere zu erlegen. Doch Bell verweigerte es ihm. „Die lassen dich auf keine halbe Meile heran”, sagte er.
Читать дальше