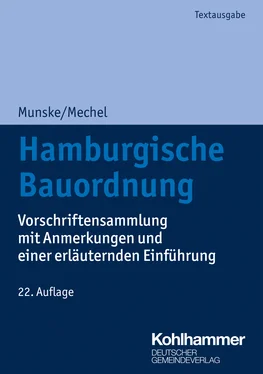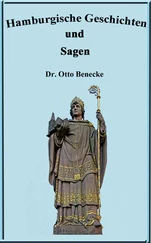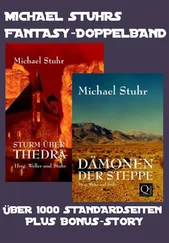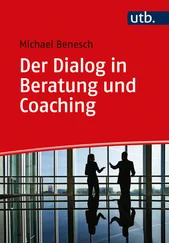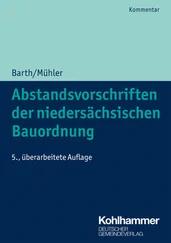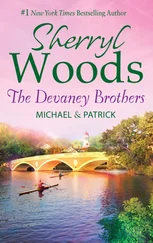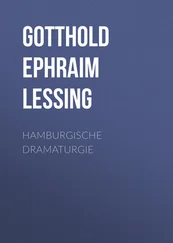4.16 Zu §§ 44 bis 52: Nutzungsbedingte Anforderungen
4.16.1 Aufenthaltsräume:Um Anforderungen der Gesundheit und der „sozialen Wohlfahrtspflege“ zu genügen, sind in § 44 HBauO bestimmte Mindestanforderungen an Aufenthaltsräume (zum Begriff s. § 2 Abs. 5 HBauO) festgelegt. Von Bedeutung ist u. a. die geforderte lichte Höhe für Aufenthaltsräume. Das Maß beträgt mindestens 2,4 m. Erleichterungen gelten für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sowie in Dachgeschossen; hier genügt eine lichte Höhe von 2,3 m.
Das früher geltende Verbot, Aufenthaltsräume von Wohnungen vollständig unterhalb der umgebenden Geländeoberfläche anzuordnen, ist mit der Bauordnung von 2005 entfallen; zu beachten ist aber die Forderung nach ausreichender Belichtung und Belüftung in Abs. 2. Auch die Bauordnung von 2005 sieht aber das Verbot, eine Wohnung insgesamt im Kellergeschoss herzustellen, vor (s. § 45 Abs. 5 HBauO).
4.16.2 Wohnungen:Die Bauordnung von 2005 stellt in § 45 HBauO, verglichen mit der Bauordnung von 1986, deutlich geringere Anforderungen an die Ausgestaltung von Wohnungen und schafft somit einen größeren Freiraum für Bauherren und Entwurfsverfasser. Vorgeschrieben sind – selbstverständlich – eine Küche oder ein Kochplatz, Bad oder Dusche sowie eine Toilette, weiterhin ein eigener Wasserzähler. Neben einem Abstellraum für jede Wohnung von mindestens 6 m 2Grundfläche ist eine zusätzliche Abstellfläche, ggf. in einem gesonderten Abstellraum, für Kinderwagen und Fahrräder herzustellen.
Wohnungen müssen überdies in Schlafräumen, Kinderzimmern und Fluren, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, mit Rauchwarnmeldern ausgestattet sein. Vorhandene Wohnungen waren bis zum 31.12.2010 mit Rauchwarnmeldern auszustatten.
Regelungen dazu, inwieweit Wohnungen barrierefrei auszugestalten sind, finden sich nunmehr in § 52 HBauO.
4.16.3 Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrradplätze:§ 48 HBauO regelt die Pflicht zur Herstellung bzw. zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge und Fahrradplätzen bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. In der Bauordnung werden dabei nur die grundsätzlichen Aussagen über den Bau von Stellplätzen und Fahrradplätzen gemacht und insbes. die Verpflichtung der Bauherren und Grundeigentümer statuiert, für das Unterbringen der Fahrzeuge aufzukommen (an erster Stelle durch das Bereitstellen von offenen Stellplätzen oder von Stellplätzen in Garagen, von Fahrradplätzen, ggf. aber auch durch Zahlung zweckgebundener Ausgleichsbeträge). Bauliche Anlagen dürfen nach § 48 HBauO nur errichtet werden, wenn die notwendigen Stellplätze für die vorhandenen und zu erwartenden Fahrzeuge der Benutzer und der Besucher der Anlagen sowie Fahrradplätze hergestellt werden. Die Zahl der notwendigen Stellplätze und Fahrradplätze, bezogen auf die unterschiedlichen Nutzungsarten, sind in der Fachanweisung „Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze“ vom 21.1.2013 enthalten (abgedruckt unter C 19 in diesem Band). Die notwendigen Stellplätze und Fahrradplätze sind in erster Linie auf dem Baugrundstück selbst oder – soweit dies für den Bauherrn möglich ist – auf einem Grundstück in der Nähe, z. B. zusammen mit anderen Pflichtigen, herzustellen.
Bei baulichen Änderungen und Nutzungsänderungen, die Auswirkungen auf den Stellplatzbedarf haben, sind nur Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Fahrradplätze für den Mehrbedarf infolge der Änderung herzustellen.
§ 48 Abs. 1a HBauO, der mit dem Dritten Gesetz zur Änderung der Hamburgischen Bauordnung vom 28. Januar 2014 (HmbGVBl. S. 33) in die Bauordnung eingefügt wurde, schafft die bis dahin bestehende Verpflichtung zur Herstellung oder zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge bei Wohnungsbauvorhaben (umfasst auch Wohnheime) ab. Bei Wohnungsbauvorhaben sind zukünftig nur die notwendigen Fahrradplätze herzustellen bzw. nachzuweisen. Satz 2 des Absatzes 1a enthält einen nicht drittschützenden, nicht einklagbaren, bauaufsichtlich nicht erzwingbaren und durchsetzbaren Appell an die Bauherrinnen und Bauherren, in eigener Verantwortung und unter Berücksichtigung des Stellplatzbedarfs der Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen oder des Wohnheims Stellplätze auch für Kraftfahrzeuge in angemessenem Umfang zu errichten.
§ 48 Abs. 2 HBauO legt fest, dass die Einrichtung von Kinderspielflächen nach § 10 HBauO sowie von Fahrradplätzen Vorrang vor der Unterbringung von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge hat. Eine Zweckentfremdung der notwendigen Stellplätze und Fahrradplätze ist unzulässig (Abs. 3).
Nach Abs. 4 kann eine Stellplatzherstellung auch untersagt werden, wenn das Grundstück durch den öffentlichen Personennahverkehr gut erschlossen ist. Dies ist nach der Fachanweisung „Notwendige Stellplätze und notwendige Fahrradplätze“ im Gebiet der Innenstadt (innerhalb des Rings 1) der Fall, so dass dort nur 25 % der notwendigen Stellplätze hergestellt werden dürfen, die Herstellung anderer Stellplätze aber untersagt wird.
Gestützt auf die Bauordnung ist eine neue Garagenverordnung (GarVO) erlassen worden (abgedruckt unter C 4 in diesem Band), mit der die vorausgegangene Verordnung von 1990 abgelöst wurde. Für die der Garagenverordnung unterfallenden Garagen und Stellplätze enthält die Verordnung spezielle Anforderungen. Soweit die Garagenverordnung keine speziellen Festlegungen trifft, bleiben die Anforderungen der Bauordnung maßgebend.
Neben den von den Bauherren und Grundeigentümern gebauten (privaten) Stellplätzen werden auch von der Hansestadt als der Trägerin der Wegebaulast Abstellmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge – in der Regel innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes – bereitgestellt (Parkplätze). Auf die Zahl der notwendigen Stellplätze nach § 48 HBauO können vorhandene Parkplätze nicht angerechnet werden.
Kann der Bauherr notwendige Stellplätze für Kraftfahrzeuge und/oder Fahrradplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem Grundstück in der Nähe nicht herstellen oder nachweisen, weil dies wegen der räumlichen Verhältnisse auf dem Grundstück oder wegen bautechnischer Gegebenheiten nicht möglich ist, so sieht die Bauordnung die Leistung eines Ausgleichsbetragesvor (§ 49 HBauO). Die Zahlungspflicht im Fall der „rechtlichen“ Unmöglichkeit, wenn also der Bauherr „kann, aber nicht darf“, ist entfallen. Die Höhe des Ausgleichsbetrages je nicht erstellten notwendigen Stellplatz oder notwendigen Fahrradplatz ist in § 49 Abs. 2 HBauO festgelegt (10.000 € bzw. 1.000 € in der Innenstadt, 6.000 € bzw. 600 € in den anderen Stadtbereichen). Den besonderen Anforderungen, die sich in Bezug auf gemischt genutzte Vorhaben (Wohnen und Gewerbe) aufgrund des Entfalls der Stellplatzpflicht für Wohnnutzungen nach § 48 Abs. 1a ergeben, wird mit § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 entsprochen (s. Bürgerschafts-Drucksache 21/9420).
4.16.4Für Sonderbauten(§ 51 HBauO) können über die Festlegungen der §§ 4 bis 47 HBauO hinausgehende Forderungen gestellt werden. Welche Gebäudetypen den Sonderbauten im Einzelnen unterfallen, ergibt sich aus § 2 Abs. 4 HBauO. Spezielle baurechtliche Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen werden auch in den sog. „Sonderbauverordnungen“ getroffen. Zu nennen sind hier beispielhaft die Versammlungsstätten-, die Verkaufsstätten- und die Beherbergungsstättenverordnung.
4.16.5 Barrierefreies Bauen:§ 52 HBauO zielt darauf ab, zugunsten von Menschen mit Behinderungenund älteren Menschensowie Personen mit Kleinkinderndazu beizutragen, eine hindernisfreie Umwelt zu schaffen, die es ihnen erlaubt, sich möglichst ohne Einschränkungen am Leben der Gemeinschaft zu beteiligen. § 52 HBauO unterscheidet dabei zwischen baulichen Anlagen, die sowohl von dem geschützten Personenkreis wie auch von jedermann besuchsweise (nicht nur gelegentlich) aufgesucht werden (öffentlich zugängliche bauliche Anlagen, wie z. B. Geschäftshäuser, Versammlungsstätten, Krankenhäuser; vgl. § 52 Abs. 2 HBauO), solchen baulichen Anlagen, die überwiegend oder ausschließlich von Menschen mit Behinderungen, alten Menschen oder Personen mit Kleinkindern genutzt werden (z. B. Tagesstätten, Werkstätten, Ausbildungsstätten für Menschen mit Behinderungen, Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime für ältere Menschen oder Tagesstätten und Heime für Kleinkinder, vgl. § 52 Abs. 3 HBauO) und Wohnungen (vgl. § 52 Abs. 1 und 4 HBauO). Für Wohngebäude regelt § 52 Abs. 1 HBauO, dass in Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein müssen. Inhaltliche Anforderungen an die Barrierefreiheit von Wohnungen sind in Abs. 4 geregelt, z. B. die Breite und Neigung von stufenlosen Zugängen (wie Rampen), ausreichend groß bemessene Türöffnungen und Bewegungsflächen.
Читать дальше