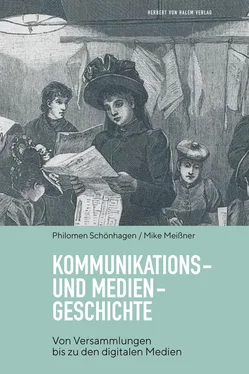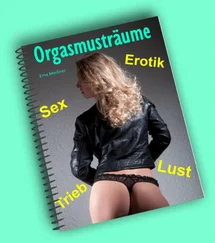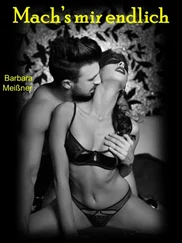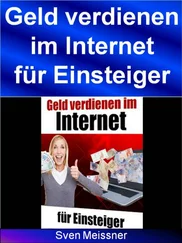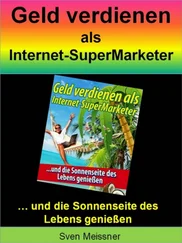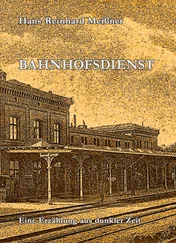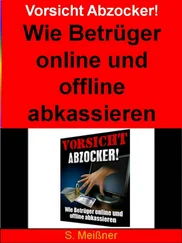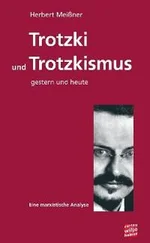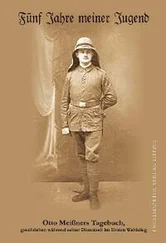In der Literatur wird meist die von Gutenberg entwickelte Typografie als eine erste (oder nach der Schrift zweite) Medien-Revolution betrachtet (vgl. u. a. WELKE 2008: 9f.). Tatsächlich aber war der Übergang von handgeschriebenen zu gedruckten Medien aktueller gesellschaftlicher Kommunikation fließend (siehe Kap. 3.2). Und auch die Form der frühen Wochenzeitungen änderte sich zunächst durch den Druck kaum (vgl. BÜCHER 1893/2017: 223). Wolfgang Behringer (2003) argumentiert in einer umfassenden Studie zur Geschichte der Post überzeugend, dass die entscheidende Kommunikationsrevolution im Europa der Frühen Neuzeit nicht der Buchdruck war, sondern die Entwicklung der Infrastruktur der Kommunikation, d. h. der Post- bzw. Verkehrsnetze. Wie oben angesprochen, war es letztlich wohl die Kombination mehrerer Innovationen – handgeschriebene periodische Zeitungen, wesentlich basierend auf dem öffentlichen Postwesen, und Typografie – die den in diesem Buch als revolutionär betrachteten Umbruch von der Versammlungs- zur journalistisch vermittelten Kommunikation ermöglicht haben. Dazu kamen soziale und politische Veränderungen, die ihrerseits wiederum durch den Buchdruck gefördert wurden (vgl. WILKE 2008: 37f.) und zu einem gesteigerten Nachrichtenbedürfnis führten. Die starke Verbreitung der Zeitung beförderte wiederum die Veränderungen in der politischen Öffentlichkeit. Solche Wechselwirkungen zwischen technischen Innovationen und gesellschaftlichem Wandel sind typisch für soziale Evolutionsprozesse (siehe weiter unten).
Interessant ist, dass sich Teilschritte der dargelegten Entwicklung auch in der römischen Antike und im ersten nachchristlichen Jahrtausend in China feststellen lassen (vgl. BÜCHER 1893/2017: 203f.; RIEPL 2014: 163; WAGNER 2014b: 214, 226, 237). Zudem sind offenbar im chinesischen Hangzhou im 12. und 13. Jahrhundert alle Entwicklungsschritte zu beobachten, also bis hin zu Wochen- und Tageszeitungen mit autonomer, journalistischer Vermittlung – aber diese blieben dort nur ein illegales Phänomen von begrenzter Dauer (vgl. HE 2015 und Kap. 3.3). Insofern hat sich erstmals im Europa der Frühen Neuzeit die journalistische Kommunikationsvermittlung dauerhaft durchgesetzt und recht schnell auch über zahlreiche weitere Weltgegenden verbreitet. Dies kann damit in Verbindung gebracht werden, dass zwar die materiellen oder technischen Voraussetzungen dieser Entwicklung – wie das Botenwesen, die Schrift und das Papier, die Typografie sowie v. a. die Einrichtung von Verkehrsnetzen und eines (allgemein zugänglichen) Postwesens (siehe Kap. 3.1) – auch andernorts zumindest größtenteils gegeben waren, nicht aber zugleich derselbe spezifische Komplex weltanschaulicher oder ideeller Faktoren wie in Europa (vgl. MITTERAUER 2004: 257ff., 274ff.). Kurt Imhof (2006: 53) spricht von einer spezifischen »Spannung zwischen Kognition und Glauben«, die für die »okzidentale Entwicklung« (anders als etwa die chinesische) prägend war. Auf diesen Faktorenkomplex wird in Kapitel 3.3zurückzukommen sein. Diese (gut dokumentierte) europäische Entwicklung steht im Fokus des vorliegenden Buches.
Auf den tiefgreifenden Umbruch durch die (gedruckten) Wochenzeitungen und den Journalismus folgten weitere, evolutionäre Entwicklungen, die durch eine Diversifizierung der Massenmedien gekennzeichnet sind. Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts entwickelten sich nicht nur die Zeitungen weiter, sondern es entstanden mit den Zeitschriften weitere Printmedien mit anderen Funktionen. Mit der Einführung und Nutzung der Elektrizität im 19. Jahrhundert kamen sodann mit Radio, (Kino-)Film und Fernsehen weitere Massenmedien dazu, die im späten 20. Jahrhundert, auf der Basis des Internets sowie des Mobilfunks, durch digitale Medien ergänzt wurden (siehe Kap. 4.3u. 5).
Mit dem Einsatz der elektronischen Medien verbindet sich nach Wagner (vgl. 2009: 109) erneut ein tiefgreifender Wandel gesellschaftlicher Kommunikation (dazu auch BÖSCH 2019: 141). Allerdings kam es nicht erneut zu einem vollständigen Umbruch hinsichtlich der zentralen Form gesellschaftlicher Kommunikation: Die journalistisch vermittelte Kommunikation und damit die medialen Öffentlichkeiten blieben weiterhin grundlegend. Insofern werden die mit den elektronischen Medien verbundenen Veränderungen hier eher als evolutionäre Entwicklungen verstanden, auch wenn sie starke Veränderungen mit sich brachten. 14Denn mit den elektronischen Medien wurde grundsätzlich wieder ein gleichzeitiger Austausch möglich, was zuvor, auf der Basis der Printmedien, nicht mehr gegeben war (vgl. WAGNER 2009: 109f.). Dies hat mit der Etablierung spezieller Informations- bzw. Kommunikationsnetze zu tun, die an die Stelle der vorher für die Kommunikationsvermittlung genutzten – langsameren – Verkehrsnetze traten. Internet und Smartphone haben außerdem wieder eine (nahezu) allgemeine Medienverfügbarkeit etabliert, 15ähnlich wie in der Versammlungskommunikation mit den natürlichen Medien. In diesem Kontext wird noch zu diskutieren sein, ob sich damit eine neuerliche Kommunikationsrevolution verbindet oder zumindest ankündigt (siehe Kap. 5).
Der Evolutionsbegriff stammt ursprünglich aus den Naturwissenschaften, ist aber auch »im Zusammenhang der Theorien des sozialen Wandels […] längst unentbehrlich geworden« (LÜBBE 2012: 278), nicht zuletzt in systemtheoretischen (Luhmann) und konstruktivistischen Zusammenhängen (vgl. SCHMIDT 1994: 261). 16Franz Adam Löffler verwendete ihn bereits im 19. Jahrhundert für seine kommunikationsgeschichtliche Darstellung des »Gebärungsprozess[es] der Presse« (WAGNER 2009: 92). Im vorliegenden Buch werden unter sozialer Evolution irreversible Prozesse (langsamer) struktureller Veränderungen verstanden, die gerichtet stattfinden. Ihre Gerichtetheit ergibt sich daraus, dass sich soziale Systeme ständig an Veränderungen ihrer Umwelt anpassen müssen, indem sie ihrerseits mit Änderungen reagieren, die im Prinzip rational, also zielgerichtet erfolgen – unter den veränderten Rahmenbedingungen. Die evolutionären Prozesse selbst sind aber insofern als »ziellos« zu bezeichnen, als eben diese veränderten Bedingungen nicht vom sozialen System selbst intendiert, sondern zufällig sind. Die Folgen und das Ende solcher Prozesse können jeweils nur im Nachhinein erschlossen werden (vgl. LÜBBE 2012: 281; ähnlich auch STUDER 2018: 36). Dabei können evolutionäre Entwicklungen letztlich auch zu einem revolutionären Umbruch führen, wie Terence P. Moran (2010: 9) erläutert: »Revolution is either rapid significant change or the moment when evolutionary change reaches a critical mass that results in significant change in a system«. Dies kann deutlich mit Blick auf den Umbruch von der Versammlungs- zur journalistisch vermittelten Kommunikation beobachtet werden, dem eine Reihe von Entwicklungsschritten vorausging (siehe Kap. 3). Zunächst wird nun aber der Ausgangspunkt aller dieser Entwicklungen näher in den Blick genommen: die Versammlungskommunikation.
6Eine ähnlich technikzentrierte Phaseneinteilung findet sich bei Moran (2010: 8).
7Zu weiteren Vorschlägen solcher Phasen oder »Perioden der Mediengeschichte« vgl. etwa auch Schmolke (2007: 236-238), North (1995: iXf.) und Faulstich (2006: 11-15). Den wohl »frühesten bekannten Periodisierungsversuch des gesellschaftlichen Nachrichtenverkehrs« (WAGNER 2014a: 243) legte Franz Adam Löffler schon 1837 vor.
8Es sei angemerkt, dass diese Ausführungen Luhmanns zu gesellschaftlichen Entwicklungen und ihrem engen Zusammenhang mit Veränderungen in der Kommunikation einige erstaunliche Ähnlichkeiten mit Überlegungen zweier Autoren des 19. Jahrhunderts (Albert Eberhard Friedrich Schäffle und Franz Adam Löffler) aufweisen (vgl. BAUER 2016: 74ff.; WAGNER 2009: 92ff.).
9Vgl. dazu auch Schönhagen (2008a), wo diese Überlegungen – damals in Teilen einem unveröffentlichten Manuskript Wagners (2005) folgend – bereits aufgegriffen wurden.
Читать дальше