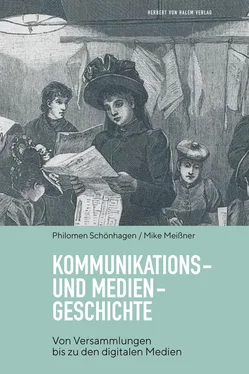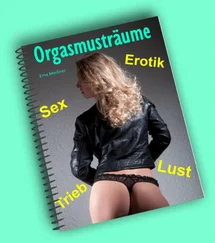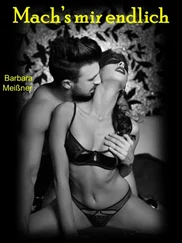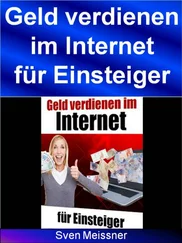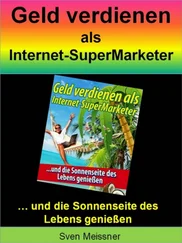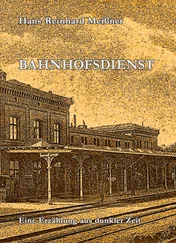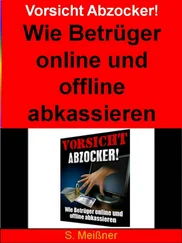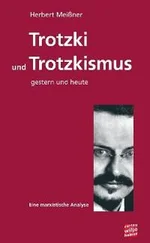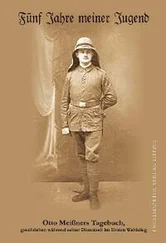Aufgrund solcher Schwierigkeiten bei der klaren (zeitlichen) Ab- oder Eingrenzung von Phasen – zumal diese typischerweise fließende Übergänge aufweisen – wird im vorliegenden Buch darauf verzichtet. Als theoretischer Hintergrund und Orientierungsrahmen der folgenden Darstellung dienen die umfassenden Überlegungen zu Entwicklungsschritten und Rationalisierungsprozessen gesellschaftlicher Kommunikation von Hans Wagner (vgl. 2014b: 217ff.; 2014a; 2009; 1995), 9die auf Beiträgen verschiedener Autoren aufbauen. Sie stehen im Zusammenhang mit dem Vermittlungstheoretischen Ansatz (VTA) (vgl. FÜRST/SCHÖNHAGEN 2020; FÜRST/SCHÖNHAGEN/BOSSHART 2015; SCHÖNHAGEN 2004; WAGNER 1978; 1995), 10der ebenfalls als Hintergrund dient.
Wie kurz erwähnt, war demnach zunächst, über den bisher längsten Zeitraum der Menscheitsgeschichte hinweg, Versammlungskommunikation die wichtigste Form gesamtgesellschaftlicher Kommunikation. Sie beruhte auf der Anwesenheit der Kommunikationsteilnehmer*innen und der (zumindest annähernden) Gleichzeitigkeit des Austauschs (vgl. WAGNER 2009: 109-112; 2014b: 233). Dabei versammelten sich Gesellschaftsmitglieder (zufällig oder absichtlich), um sich mündlich und von Angesicht zu Angesicht (face-to-face) über diverse aktuelle Fragen und Probleme auszutauschen. In diesem Zusammenhang ist auch von »Präsenzöffentlichkeit« die Rede (GERHARDS/NEIDHARDT 1990: 24). Die Versammlungskommunikation war außerdem durch eine (zumindest weitgehende, wenn man von gehörlosen Menschen absieht) allgemeine »Medienverfügbarkeit« gekennzeichnet (WAGNER 2009: 111; 2014b: 233), d. h., alle potenziellen Kommunikationsteilnehmer*innen verfügten über die zur Kommunikation benötigten Medien (Sprache, Gesten, Mimik).
In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass Gesellschaften und Gemeinschaften 11notwendigerweise der Kommunikation bedürfen, sowohl um sich überhaupt zu konstituieren als auch für ihre weitere Aufrechterhaltung (vgl. BERGER/LUCKMANN 1966/1980). Dabei bringen typischerweise – schon in der frühen Versammlungskommunikation – Sprecher*innen von Gruppen Bedürfnisse, Forderungen etc. ein, worauf andere reagieren (können). Auf deren Reaktionen kann es erneut Reaktionen geben etc. Man kann auch sagen, dass Gesellschaft nur durch Kommunikation existiert, was Wagner (2014a: 245; Hervorh. d. Verf.) als das » kommunikative Prinzip « bezeichnet. Dieses findet sich bereits in der antiken Philosophie (vgl. auch BEIERWALTES 1999: 25-28). In diesem Sinne sprach Thomas Luckmann in einigen späten Arbeiten nicht mehr nur von der »social«, sondern auch von der » communicative construction of reality« (zit. nach SCHNETTLER 2006: 128; Hervorh. d. Verf.).
Vor diesem Hintergrund erscheint Versammlungskommunikation als die »›Urform sozialer Kommunikation‹« (SCHÖNHAGEN 2008a: 2). Sie stieß jedoch mit dem Anwachsen und der zunehmenden Ausdifferenzierung von Gesellschaften an Grenzen: Eine Versammlung aller bzw. aller mitspracheberechtigten Mitglieder an einem Ort zur gleichen Zeit war nicht mehr realisierbar. Dieses Problem der »Dislokation der Kommunikationspartner« (WAGNER 1995: 19) konnte nur gelöst werden, indem die Versammlungskommunikation durch einen anderen Kommunikationsmodus abgelöst wurde: die » Kommunikation über Distanz « (WAGNER 1995: 21; Hervorh. d. Verf.), d. h. zwischen nicht-anwesenden Kommunikationspartnern (auch als Fernkommmunikation bezeichnet). Historisch kann zunächst eine Zunahme von derartigen Kommunikationsformen, ergänzend zur Versammlungskommunikation, beobachtet werden. Dabei bedurfte die Kommunikation für ihr Zustandekommen der technischen und/oder menschlichen Vermittlung. Insbesondere dieses Einschalten von Vermittlern veränderte den gesellschaftlichen Nachrichtenaustausch grundlegend. Wolfgang Riepl spricht in seiner erstmals 1913 veröffentlichten Studie über das Nachrichtenwesen des Altertums (2014: 93) davon, dass an die Stelle der Versammlung zunehmend das »Prinzip der Auseinandertragung oder Versendung« von Mitteilungen trete. Das heißt, dass zum einen der kommunikative Austausch nicht mehr annähernd gleichzeitig zwischen Anwesenden stattfand, wie in der Versammlungskommunikation, sondern immer häufiger zeitversetzt (sukzessiv) zwischen räumlich voneinander entfernten Personen, also Abwesenden. Zum anderen war bei der Versammlungskommunikation jede*r, die oder der etwas mitteilen wollte, auch selbst Übermittler*in dieser Nachricht. Wagner (1978: 96) bezeichnet dies als »Eigen«- oder »Selbst-Vermittlung«. Fernkommunikation dagegen beruht auf der Trennung zwischen dem Vorgang der Mitteilung selbst und ihrer Übermittlung an die Angesprochenen. Erst diese Trennung ermöglichte es dann auch, eine Vielzahl von Mitteilungen unterschiedlicher Urheber*innen mittels einer Person bzw. in einem Medium zusammenfassend weiterzugeben. Dies war der Kern der Lösung, um unter den Bedingungen komplexer und räumlich ausgedehnter Gesellschaften eine für alle überschaubare und zugängliche Kommunikation zu realisieren. Allerdings ist es in diesem Fall keineswegs mehr so selbstverständlich wie bei den natürlichen Medien, dass jeder potenzielle Kommunikationspartner über solche Medien verfügen kann (vgl. WAGNER 2009: 106f.). Im Gegenteil fand eine zunehmende Konzentration der Vermittlung in Form professioneller Vermittler bzw. von Medienorganisationen statt (vgl. WAGNER 1995: 15ff.). Diese entwickelten zudem eine wachsende Autonomie von den an der Kommunikation Beteiligten (Individuen und insbesondere Gruppen). Mit diesen Rationalisierungs- und Konzentrationsprozessen erhöhte sich schrittweise die Effizienz der Kommunikationsvermittlung (siehe im Detail Kap. 3), aber auch die Abhängigkeit der potenziellen Kommunikationspartner von den professionellen Vermittlern. Letzteres führte sodann zu Maßnahmen der »Gegenrationalisierung« (WAGNER 1995: 56), u. a. in Form von Öffentlichkeitsarbeit gesellschaftlicher Akteurskollektive bzw. von Organisationen (siehe Kap. 4.1).
Die wachsende gesellschaftliche Differenzierung und die Weiterentwicklung der Kommunikation über Distanz bedingten und verstärkten sich wechselseitig: Kommunikation über Distanz ermöglichte stärkere gesellschaftliche Differenzierungen, die ihrerseits verstärkte Kommunikation(svermittlung) notwendig machten (vgl. KNIES 1857/1996: 58; HALBACH 1998: 277; WAGNER 2009: 92f.). 12Hartmut Winkler (1997: 204) weist ebenfalls darauf hin, dass »eine direkte Beziehung zwischen dem Maß der gesellschaftlichen Differenzierung und dem gesellschaftlichen Kommunikationsbedarf« bestehe. Bezug nehmend auf die Theorie der reflexiven Modernisierung des Soziologen Ulrich Beck sowie auf andere Autoren erläutert Lothar Mikos (1994: 9) diesen Zusammenhang am Beispiel des Fernsehens:
»Der gesamte Prozeß der reflexiven Modernisierung, der durch die Ausdifferenzierung der Gesellschaft und durch die Pluralisierung von Lebensformen gekennzeichnet ist, wurde ›in entscheidendem Maße durch die Kommunikationsmedien gestützt und oft erst auf den Weg gebracht‹ […]. Nur die Medien sind noch in der Lage, die Integration der sich ausdifferenzierenden Gesellschaften zu sichern. […] Zugleich verstärken die Medien jedoch die weitere Segmentierung und Pluralisierung der Gesellschaft«.
Das vorläufige Ergebnis der dargelegten (Rationalisierungs-)Prozesse war die Entstehung von Zeitungen sowie des Journalismus. Zunächst wurden Zeitungen handschriftlich vervielfältigt; erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde der Buchdruck, der in Europa Mitte des 15. Jahrhunderts entwickelt wurde, zur Rationalisierung der Zeitungsproduktion genutzt. Die damit ermöglichte massenhafte Vervielfältigung führte dazu, dass die Kommunikation über Distanz, genauer die journalistisch vermittelte Kommunikation die Versammlungskommunikation als zentrale Form des gesellschaftlichen Austauschs ablösen konnte. Dadurch wurden auch mediale Öffentlichkeiten anstelle von Präsenzöffentlichkeiten bestimmend (vgl. FÜRST/SCHÖNHAGEN/BOSSHART 2015: 334f.; BEIERWALTES 2000: 28-31). Dies bedeutete einen tiefgreifenden Umbruch in der gesellschaftlichen Kommunikation, der zu Recht als » Kommunikationsrevolution « (WAGNER 2009: 106; Hervorh. d. Verf.) bezeichnet werden kann. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die Versammlungskommunikation nicht obsolet wurde, sondern ergänzend in vielen gesellschaftlichen Bereichen bis heute bestehen geblieben ist, wie z. B. in Parlamenten, bei Bürger- oder Vereinsversammlungen etc. 13
Читать дальше