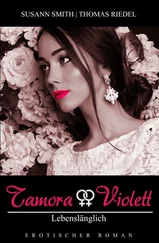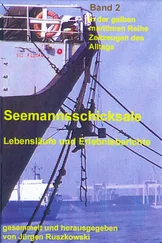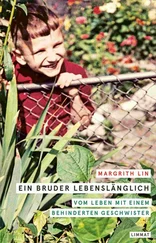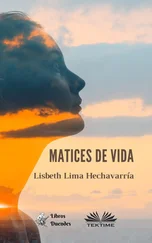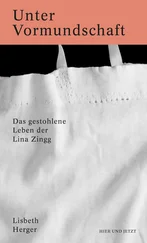Im städtischen Waisenhaus, einem ehemaligen Kloster an der alten Stadtmauer, wird ihm vorerst nichts geschenkt. Die Stadtkinder mokieren sich über Robis breiten Stiefelgang, sie reiben ihm seinen Stallgeruch unter die Nase, und auch sein St.-Galler-Dialekt bringt ihm keine Sympathien ein. Robi, unsicher, verletzt, in allem blockiert, wird zum Sonderling. Und doch macht ihn die neue, unbekannte Welt neugierig und auch etwas mutiger. Immerhin ist es eine Welt ohne Strafen und ohne lebensfeindliche Bibelzitate. Und man darf sogar über die riesengrossen Turnschuhe des Waisenvaters lachen. Im grossen Haus mitten in der Stadt, wo nicht mehr das Auge Gottes wacht, sondern jenes des Staates, ist man vor Willkür weit besser geschützt als früher in der Villa Wiesengrund. Und ausserdem gibt es nun plötzlich eine echte Mutter, die manchmal sonntags zu Kaffee und Kuchen lädt, die einen Freund hat – ein Verdingkind auch er –, einen, der Robi wohlgesonnen ist und der ihn ab und an zusammen mit der Mutter in seinem schicken Auto auf ein Fährtchen mitnimmt, zu seiner eigenen Pflegefamilie, in die hintersten Hügel des Juras.
In dieser neuen Welt trifft Robi, inzwischen im letzten Schuljahr angekommen, endlich mit seinem Zeichentalent auf aufmerksame Resonanz. Ein schulisches Zwischenjahr soll die Berufswahl weiter klären, mit 16 beginnt er dann in einem grösseren Ingenieurbüro eine Lehre als Bauzeichner. Die vielen Leute, die vielen Büros und die vielen Chefs machen dem Heimbuben Angst. Einmal duckt er sich, kurz danach schiesst er weit übers Ziel hinaus, Geltungsdrang und Gefühle absoluter Minderwertigkeit jagen ihn durch den Tag. Er ist halt- und orientierungslos. Einzig seine Arbeiten sind konstant gut und finden Anerkennung. Die Abschlussprüfung nach drei Lehrjahren quält ihn mit ungeahnten Ängsten, doch er schafft das Diplom. Und zwar mit Bestnote und Auszeichnung.
Kurz vor Weihnachten 1968, einen Monat vor seiner Volljährigkeit, verlässt Robi nach insgesamt 17 Heimjahren das städtische Waisenhaus Richtung Freiheit. In seiner Tasche stecken die Einberufung in die Armee und ein Mietvertrag für ein WG-Zimmer, sein ausgezeichneter Lehrabschluss, ein Goldvreneli, das ihm der Waisenvater für die Bestnote gab, und an seinem Arm glänzt eine Herrenuhr, das Geschenk seines Lehrmeisters als Anerkennung für den glanzvollen Abschluss. Dieser hofft, dass der begabte Zeichner nach der Rekrutenschule zurück in den Betrieb kommt. Er hat sich entschlossen, den mittellosen jungen Mann zu fördern, und bietet ihm an, ihm auf Betriebskosten ein Studium an der Technischen Hochschule zu finanzieren. Doch allein die Vorstellung davon jagt Robi das Blut in den Kopf und lässt ihn schwindlig werden. Denn der mit Rang ausgezeichnete Bauzeichner bleibt ein schwer traumatisierter ehemaliger Heimbub, der vor jeder Prüfung, jedem kleinen Auftritt monströsen Ängsten ausgeliefert ist und der für sich beschlossen hat, solche Situationen künftig radikal zu vermeiden. Deshalb auch will er sich von seinem erlernten Beruf verabschieden, der hohe Erwartungsdruck als Folge seines prämierten Abschlusses ist für ihn entsetzlich, da gibt es nur eins, so schnell wie möglich zu fliehen, Neustart auf Feld eins, wo keinerlei Erwartungen ihn bedrängen. Überraschend schlägt er deshalb das Angebot seines Meisters aus und erzählt ihm von seinen Plänen, ins Gastgewerbe zu wechseln. In jene Branche, wo weder nach der Kinderstube noch nach Abschlüssen gefragt wird. Doch das verrät er seinem konsternierten Chef natürlich nicht und lässt diesen mit seiner Kündigung ratlos und auch enttäuscht zurück.
1970, nach der Rekrutenschule, während der ein begeisterter Leutnant den braven Soldaten mit seiner vorbildlichen Disziplin zum Offizier machen will und er selbst das Unglück gerade noch zu verhindern weiss, beginnt Robi Minder seine Karriere in der Welt der Gastronomie. An einer durch seine Mutter vermittelten Stelle, im Restaurant Safran Zunft, mitten in Basels Altstadt. Schon bald wird der Quereinsteiger auch hier gefördert. Der Chef steckt ihn in einen schwarzen Anzug mit Fliege und schickt ihn als sein Aide du Patron in die oberen Säle, wo er rauschende Feste und Bankette zu organisieren und das Personal zu führen hat. Damit aber gerät Robi Minder erneut in jene Hölle, die er zwingend zu vermeiden sucht: Nun wird jeder Tag ein Prüfungstag, wird jede Serviererin, die er für ein Bankett engagiert, zu einer Prüfungsexpertin. Und immer muss er das Beste liefern, muss es allen recht machen. Hinter dem galanten jungen Bankettmanager versteckt sich ein hochsensibler, zutiefst verletzter Bub, der täglich durch die Schleuder seiner Ängste geworfen wird. Robi Minder ist immer auf Draht, immer unter Stress, Entspannung kann der Gehetzte nur noch mithilfe von Alkohol finden. Und so beginnt er zu trinken. Regelmässig. Wohldosiert über den Tag verteilt. Der Stoff ist immer greifbar, er selbst ein äusserst kontrollierter Mensch, dem abgestufte Mässigkeit leichtfällt. Die verräterische Fahne aus seinem Mund lässt sich mit Mineralwasser ausschwemmen. Und den Menschen kommt Robi Minder sowieso nicht zu nahe. Mit etwas Alkohol bleibt das gefürchtete Zittern seiner Hände aus. Und sein instabiler Schritt wird sicherer.
Noch ein weiterer Trick hilft ihm über seine täglichen Runden in den grossen Bankettsälen. Seit seiner Kindheit weiss Robi Minder um sein besonderes Talent in der Nachahmung von Menschen. Mit Leichtigkeit imitiert er ihren Schritt, ihre Gestik, den Tonfall ihrer Stimmen. Und nun entdeckt er, wie nützlich solch ein Rollenspiel sein kann. Denn wenn er als Stellvertreter seines Chefs sich selbst verlässt und ein anderer wird, wenn er sozusagen aus seiner Haut fährt und sich eine fremde überzieht, wird alles ein Spiel. Und seine Ängste werden leiser. Und so fängt er an, seinen Patron zu imitieren, läuft mit dessen wiegendem Gang durch die Säle, knetet sanft sein rechtes Ohrläppchen, während er redet, oder streicht sich mit dem Zeigefinger über den Nasenrücken, genau wie dieser, und auch die Tonalität der Stimme des Patrons kopiert er und seinen so unverkennbaren Basler Dialekt. Mit etwas Alkohol im Blut und in der Körperrolle des Chefs schafft es Robi, den Rotwein ohne Kleckern zu servieren, den Teller ruhig vor den Gast zu stellen und dabei freundlich zu lächeln; ist Robi Minder selbst am Werk, landet der kostbare Tropfen neben dem Glas, verschüttet er die sorgfältig angerichteten Teller, knicken gar beim Balancieren der Gläser seine Beine gefährlich ein. Seine Rolle als gewandter Kellner gefällt den Gästen. Sie sehen den leiblichen Sohn des Safran-Wirts am Werk und erfreuen sich am geglückten Spiegelspiel vererbter Gene.
In den ersten Jahren seiner Servicetätigkeit lebt Robi Minder mit einem Kollegen zusammen, dann zieht er, der stille Sonderling, in eine Einzimmerwohnung um. Lebt vorerst allein, bis eine Reise sein Single-Dasein unerwartet verändert. Er fliegt mit einem alten Schicksalsgenossen aus dem Waisenhaus, wie vor Jahren vereinbart – und was er verspricht, das hält er auch –, ins thailändische Eldorado käuflicher Frauen. Es ist nicht Robi Minders Welt. Sein Blick verfängt sich denn auch nicht in den präsentierten Katalogfrauen, frei verfügbar, da im Arrangement inbegriffen, sondern er flieht zu einer Schattenfrau, die weinend in einem Winkel des Etablissements sitzt, «out of service», wie der Besitzer verärgert deklariert. Diese und nur diese will er haben, wenn er denn schon wählen soll. Er nimmt die Frau mit auf sein Zimmer und weiss sofort, er wird sie retten, die Verlorene, wird sie ihrem Elend entreissen, will sie so schnell wie möglich heiraten und in die Schweiz holen. Und das tut er auch. Und so teilt er bald einmal seine kleine Wohnung mit dieser ihm gänzlich unbekannten Frau, deren Sprache er nicht kennt, deren Kultur ihn in ihrer Fremdheit täglich neu herausfordert. Mit grossem Eifer lernt er ihre Sprache, sie führt ihn in die thailändische Küche ein, und später wird sie im Restaurant des inzwischen selbstständig wirtschaftenden Robi Minder kochen. Das Glück will sich dennoch nicht einstellen. Vier Jahre später sind die beiden geschieden.
Читать дальше