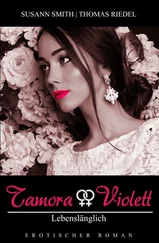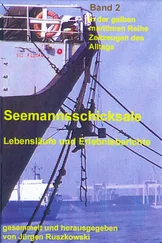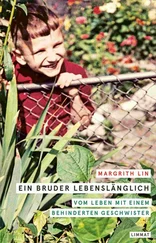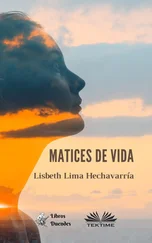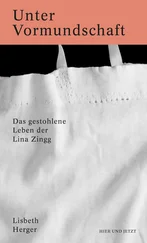Dafür aber ist das Jahrzehnt im Kinderheim Wiesengrund genauestens dokumentiert, in einem hauseigenen Archiv, das erst 2015 dem St. Galler Staatsarchiv übergeben wurde und in dem nebst den Akten zum Heim und der Stiftung fast alle Personenakten zu den Kindern aufbewahrt wurden. Ein Glücksfall für die Rekonstruktion dieser Kinderschicksale, auch wenn Robi Minder, das ehemalige Heimkind, zuerst einmal bitter enttäuscht war, als er das 2,4 Kilogramm schwere Aktenpaket, angeliefert aus St. Gallen, mit Herzklopfen öffnete. Denn schnell wurde dem unruhig Suchenden klar, dass in den Hunderten von Blättern, Berichten und Briefen herzlich wenig über seine eigene Entwicklung und die seiner Schwester zu finden sein würde, keine sorgfältig formulierten Entwicklungsprotokolle mit pädagogisch und psychologisch geschultem Blick auf das psychische Wohl der Kinder, mit all den Fortschritten und Sorgen darum herum. Der gewaltige Aktenberg ist kein Seelenspiegel kindlicher Entfaltung, sondern das Monument einer immensen Verwaltungsarbeit. Er illustriert eindrücklich den ungeheuren administrativen Aufwand, den die Heimeltern in der Zusammenarbeit mit den Behörden und Verwandten zu leisten hatten. Oder den sie meinten, leisten zu müssen. Damals bedeutete Kommunikation fast immer den Griff zum Stift oder zur Schreibmaschine, Telefonieren war teuer und für Notfälle reserviert, Internet und Mailverkehr gab es gar nicht. Alles wurde brieflich organisiert, erfragt, bestätigt, festgehalten, in umfangreichen Korrespondenzen mit der Basler Behörde, mit den Eltern, mit fernen Familienmitgliedern und den neu ernannten, den Kindern völlig unbekannten Fürsorgepaten. Es geht darin um Kostgeldabrechnungen für den Heimaufenthalt, aber auch um Kostengutsprachen für Krankheiten, für den Zahnarzt, für verbilligte Fahrkarten bei Reisetätigkeiten und weiter um Antworten zu Besuchs- und Feriengesuchen und um die Klärung von Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken. Die Eltern, der Götti und die Gotte erfragen die Wünsche der Kinder, die Heimeltern antworten mit pragmatischem Blick auf den karg bestückten Kleiderschrank. Irgendwo im Brief versteckt sich stets ein obligater, stereotyper Satz zum Befinden der Kinder, die meist als «gesund und munter» beschrieben werden. Nur schwerere Krankheiten, die eine Arztvisite oder – wie bei Bethli wegen seines späteren chronischen Nierenleidens als Folge des ewigen Barfusslaufens – einen Spitalaufenthalt erfordern, werden erwähnt. Sonst geht es den Schützlingen offenbar immer gut, und die Kinder selbst bestätigen dies in ihren von den Heimeltern verordneten und kontrollierten und in schöner Schrift geschriebenen Dankesbrieflein, wie man sie im Heimarchiv zu Dutzenden abgelegt findet. Glückliche Vorzeigekinder also, gelegentlich belegt ein mitgeschicktes Foto, auf dem gestrahlt oder zumindest gelächelt wird, das festgeschriebene Kinderglück.
Der verwaltungstechnische Aktenberg mit seinen rund 400 Blättern dokumentiert also diese aufreibende Administration, ist aber gleichzeitig ein Berg des Verschweigens, überschichtet das Wesentliche im kindlichen Alltag der Geschwister. Die spärlichen kleinen Freuden. Und noch viel mehr die ganz grosse Verlassenheit der beiden, ihre Trauer und Wut. Und die qualvolle Hilflosigkeit in der Zwinge dieser evangelikalen Heimdressur, bei der Gewalt nicht als Ausnahme, sondern in der Regel eingesetzt wird. Die Heimeltern Furrer sind fest entschlossen, ihren dem Laster und der Sünde entsprossenen Zöglingen das Böse auszutreiben und sie zu gottesfürchtigen und nützlichen Mitgliedern der Gemeinde Gottes zu erziehen. Dazu sind viele Mittel recht. Zuallererst die religiösen Rituale, das tägliche Bibellesen, das Beten vor und nach jeder Mahlzeit, das abendliche Absingen frommer Lieder, die regelmässige Selbstbezichtigung begangener Sünden, jedes Kind vor seinem Stühlchen kniend, alles vor der ganzen Heimgruppe. Diese Tagesrationen frommer Zucht und Ordnung wirken. In Robi wächst ein Gespinst von Heilsversprechen und Versagen, von göttlicher Bestrafung und unlösbarer Schuld, das sich zu existenzieller Wirrnis und zu Ängsten verdichtet. Er fühlt sich von einem mächtigen Gott verfolgt, der ihn in jedem erdenkbaren Winkel zu jeder Tages- und Nachtzeit beobachtet und alles sieht. Personifiziert ist dieser mächtige Gott in der Heimmutter Rosmarie, der Herrscherin über Heim und Kinder, die von den Kindern mit Mueti angesprochen werden will. Rosmarie Furrer sieht alles. Und noch viel mehr. Sie setzt Regeln und kontrolliert. Ihr grosses Auge wacht nicht nur über die Ess- und Arbeitsdisziplin ihrer Zöglinge, sondern auch über die spärliche Freizeit und über das Geschehen unter der Bettdecke. Zudem belohnt sie intrigantes Verhalten, wenn sich die Kinder untereinander verpetzen. Erzogen wird im Wiesengrund vor allem mit Strafen. Die Strafmacht der Heimmutter aber ist brutal und grenzenlos, wird zudem mit undurchschaubarer Willkür eingesetzt. Es gibt vorhersehbare Strafen, etwa, wenn Robi verbotenerweise schwatzt, und solche, die völlig unerwartet auf ihn niederfahren, wie ein göttlicher Blitz. Dabei verlässt Rosmarie Furrer den damals üblichen Rahmen der gewalttätigen schwarzen Pädagogik. Im Wiesengrund werden Schläge zum täglichen Brot, für die Kinder, aber genauso für die züchtende Schlägerin. Ihr Blick wird dabei glasig, der Schritt stramm, die Hand ein hartes Schlaginstrument. Sie schlägt und schlägt, ins Gesicht, auf den Kopf, auf den nackten Po, holt den Teppichklopfer als Verstärkung, sie zerrt wild an den Haaren, manchmal kniet sie gar auf den schmächtigen Rücken des Buben, greift in sein Haar und rüttelt den Kopf, traktiert ihn gleichzeitig mit Fäusten und Fingernägeln. Auch Robis kleine Schwester wird von der Gewalt nicht verschont. Auch ihr werden Haarbüschel ausgerissen. Auch sie wird die Treppe hinuntergestossen, sie schlägt unten hart an einem Korpus auf, die Delle im Kopf bleibt lebenslanges Zeugnis. Wenn Mutter Furrer mit Schlagen anfängt, kann sie oft nur schwer wieder aufhören. Manchmal wird der Tatort auch diskret verlegt. In das Schlafzimmer ihrer Tochter. Oder, weit schlimmer, in die Waschküche im Keller. Dort wird «den kleinen Teufelchen» dann zünftig auf den Leib gerückt. Etwa wenn Übermut die Buben verführt, sie sich, erhitzt nach dem Völkerballspiel, mit dem Gartenschlauch abspritzen und dabei auch noch ihren Spass haben. Die Heimmutter greift sich den schmächtigen Robi, zerrt ihn nach unten, schlägt mit dem Dichtungsschlauch der Waschmaschine auf ihn ein, schlägt und schlägt, die Bestrafung gerät zum sadistischen Exzess, der erst aufhört, als der Bub ohnmächtig geworden ist.
Manchmal zeigt sich der Sadismus auch verdeckter. Zum Beispiel beim wöchentlichen Baden. Der heute bald siebzigjährige Robi Minder, noch immer feingliedrig und schlank, erinnert sich nur zu gut an das wöchentliche Ritual in der grossen Wanne: Die Kinder werden der Reihe nach abgefertigt, für jedes nächste Kind ist das Badewasser kälter, warmes Nachgiessen untersteht gänzlich der Laune der Heimmutter. Es gefällt ihr, Robi wieder und wieder mit kaltem Wasser zu übergiessen, so lange, bis ihm das Atmen schwerfällt. Ihr fester Griff erlaubt keine Flucht. Seife in den Augen muss ertragen werden, das spontane Reiben mit den Händchen ist untersagt. Und wenn Robi sich dem Prozedere nicht ganz und gar unterwirft, riskiert er anschliessend Prügel auf den Hintern. Sadistische Lust ist wohl auch dann im Spiel, wenn Heimmutter Furrer den kleinen Robi ins Stickzimmer beordert, zu den fleissig arbeitenden Mädchen, ihn dort auf einen Schemel stellt und ihn die Hose ausziehen lässt, um ihm vor aller Mädchenaugen einen seiner wiederkehrenden und arg schmerzenden Furunkel am Po aufzuschneiden. Auch das ein sich wiederholendes Ritual. Oder als sie den Buben in die Waschküche holt, ihn vor die Zaine mit den niedlichen Welpen der Heimhündin Dolly stellt, jener Hündin, die Robi innig liebt und bei der er sich etwas Zärtlichkeit holt, und ihm dann einen Haselknüppel in die Hand drückt und gebietet, den wuseligen Wurf, die süssen Welpen, einzeln mit Kopfschlag zu töten. Robi Minder weiss heute nicht mehr, wie er die Qual ausgestanden hat. Er erinnert sich einzig, dass er stammelte, er könne das nicht, dann steigt das grosse Blackout in seinen Kopf, und die Stimme wird zittriger, wenn er nach der Fortsetzung sucht. Und ihm stattdessen einfällt, wie er manchmal auch nur in die Verbannung in die kleine Dunkelkammer musste, in jene Montageöffnung direkt unter der Toilette, wo sich verschiedene Abwasserrohre kreuzten und wo es stank. Ein dunkler, feuchter, kleiner Zwinger, in dem auch kleine Kinder nur kauernd Platz fanden.
Читать дальше