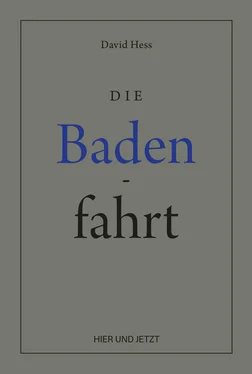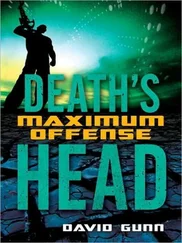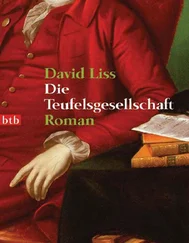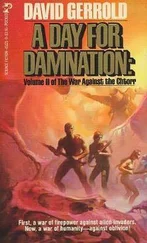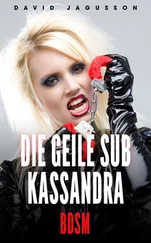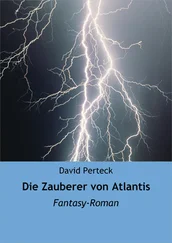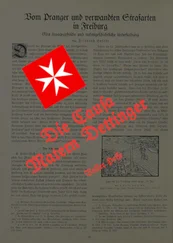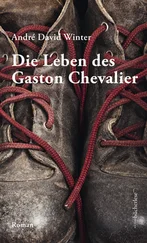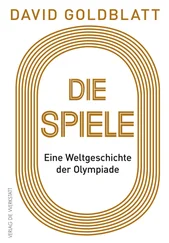Aber das älteste Mädchen ist so stille. Es ist nicht krank gewesen, es bedarf keiner Stärkung. Was fehlt ihm denn? Es möchte eben auch mit, und sollte das gute Kind allein zu Hause bleiben? Gewiss nicht, es soll auch mitkommen! Und das Mädchen springt hoch auf vor Freude und klopft jubelnd in die Hände.
Plötzlich erinnert man sich, die Stubenmagd habe seit der letzten Wäsche eine geschwollene Hand. Könnte sie nicht auch baden? Ja, ja, sie soll auch baden. Aber dann kann sie die Herrschaft nicht bedienen? Freilich kann sie’s dann nicht. Man nimmt also auch die Köchin mit, man kann die Köchin nicht entbehren. Und so geschieht es oft, dass am Ende einer solchen Beratung die ganze Haushaltung auf dem Verzeichnis der Reisegesellschaft steht.
Vor Zeiten pflegte man sich mit Laxieren und Purgieren systematisch auf die Kur vorzubereiten und Manna und Senesblätter mussten notwendig allen Badekandidaten das Bauchgrimmen verursacht haben, bevor sie sich auf die Fahrt zu begeben wagten. Heutzutage nimmt man es damit nicht mehr so genau.
Es werden Briefe mit den Badwirten gewechselt. Nach vielem Hin- und Herschreiben findet sich endlich das gewünschte Gemach, es ist bestellt. Bis zur Abreise gibt es noch vieles zu ordnen und zu bereiten, und die Kinder sprechen und träumen von nichts als von Baden und von den Herrlichkeiten, die dort auf sie warten.
Allein je näher der zur Abreise bestimmte Tag heranrückt, desto auffallender zeigt sich die Unmöglichkeit, alles, was mit soll an Menschen und Gerätschaft, in einen einzigen Wagen zusammenzupferchen. Entweder muss man also zwei Wagen mieten, und das kostet viel Geld, oder man benutzt die wohlfeilere Gelegenheit, die sich im Sommer wöchentlich mehrere Male bietet, im Schiff nach Baden zu fahren.
Ich bin oft dahin gereist, im Wagen, zu Pferd und zu Fuss, aber nie so angenehm, nie so schnell wie im Schiff. Ich rate demnach jeder zahlreichen Gesellschaft, mit allem Gepäck bei günstigem Wetter auf der Limmat 1nach Baden zu fahren, und zwar nicht in einem eigens gemieteten Nachen, wie vornehme Leute etwa hinabzureisen pflegen, die an keine bestimmte Stunde gebunden sein und sich nicht unter allerlei Volk mischen mögen, sondern im öffentlichen Schiff, wo für 16 Schillinge und ein kleines Trinkgeld einsitzen kann, wer will.
Diese Schiffe sind freilich keine Coches d’eau, keine Treckschuiten, keine Jachten. Es sind lange, schmale, gebrechliche Dinger, auf denen man sich dem reissenden Strome preisgibt. Man heisst sie Weidlinge wegen der Schnelligkeit, mit der sie fortschwimmen. 2Englische Seeoffiziere, welche die Welt umsegelt hatten, weigerten sich oft, ihr Leben an solche drei Bretter zu wagen. Lange Gewohnheit macht den Zürcher kühn; sorglos setzt er sich mit seinen Geliebten ein und vertraut seinen Göttern.
An verschiedenen Tagen fahren diese Schiffe im Sommer nach Baden. Am meisten aber sind die besetzt, welche am Sonnabend in der Mittagsstunde abgehn. Von der Hitze hat man nichts zu fürchten, auf dem Wasser ist ein ewiges Spiel von kühlen Lüften. Um die Zeit der Zurzachermesse, welche mit der Kurzeit zusammentrifft, ist der Andrang der Reiselustigen beträchtlich. Viele junge Leute wollen über den Sonntag ihre Bekannten im Bad besuchen und dem Staadhofball beiwohnen; sie reisen auch mit dem Schiff. Nebst den vielen Kisten und Ballen und Reisesäcken, die vorn und hinten aufgetürmt werden, finden zwei bis 36 Personen Platz in einem solchen Nachen. An schönen Sonnabenden werden zwei bis drei derselben erfordert, die Leute alle aufzunehmen, welche vor der Wohnung des Schiffmeisters oder an der Landveste unten an der Rosengasse auf die Abfahrt harren.
Der Schiffsmeister hat Lebensart, er weiss zu unterscheiden. Zuerst schiebt er den Pöbel von Krämern und Juden, die nach Zurzach wollen, dann Bauern, Knechte und Mägde der Badgesellschaften und die simplen Passagiere 3vor, weist ihnen ihre Plätze an, und nur zuletzt fördert er die vornehmen Herren und Damen auf die hintersten Sitze, hinter welchen er gewöhnlich selbst das Steuer führt, von wo aus man die ganze Schiffsgesellschaft übersehen kann und wo man auch bei der Fahrt durch den Kessel weniger von den plätschernden Wellen bespritzt wird.
Eine Menge Zuschauer steht auf der Landveste. Verwandte und Bekannte der Abfahrenden, Neugierige, die das Gewühl herbeilockt, Vorübergehende, die verweilen, bis das Schiff vom Land stösst. Das Ganze ist bei heiterem Wetter ein buntes, fröhliches, malerisches Schauspiel.
Sowie ein Nachen vollgepfropft ist, wird er umgewendet und gegen den Wollenhof gelenkt. Da ergreift ihn die Gewalt des reissenden Stromes. Die Schiffsleute brauchen nicht zu rudern, sie haben genug zu tun, nur immer genau die Richtung zu beobachten, welche das Fahrzeug nehmen soll, um nicht gegen Pfähle und Mauern zu stossen. Sie sind sehr vorsichtig, und dass sie sich nicht etwa vor der Abfahrt berauschen, dafür hat der Schiffsmeister bei Eid und Pflicht und schwerer Verantwortung zu sorgen.
Eine reizendere Wasserreise als diese ist kaum denkbar; sie lässt sich im Kleinen mit der Rheinfahrt von Mainz bis Köln vergleichen. Wie ein Pfeil vom Bogen geschnellt, fliegt der leichte Nachen auf blaulichen Wellen dahin. Die Gegenstände wechseln jede Minute; kaum hat man eine bedeutende Stelle erreicht, so verschwindet sie wieder, verdrängt von einer andern, die das Auge auf sich zieht. Von der Landveste ausgelaufen, befindet man sich schon im Hui an der Spitze des Ötenbachergartens bei der Papiermühle, wo am Abend des 22. Heumonats 1350 vor der Mordnacht der besonnene Fischer Bachs den verräterischen Grafen von Toggenburg mit seinen beiden Gefährten in die Fluten versenkte und sich dann von seiner Obrigkeit die silbernen Panzerschuppen der von ihm in der Reuse gefangenen Fische zur Belohnung erbat. Nicht vergebens heisst diese Stromgegend die Schnelle. Man hat sich kaum bedacht, so ist man schon unterm langen Steg dahin und schwebt längs den schattigen Lindengängen des Schützenplatzes, an dessen Spitze der Sihlstrom sich mit seiner jugendlichen Braut, der Limmat, vermählt. Ade, Zürich!
Wer etwa dort oben im Beckenhofunter dem dunklen Kastaniengewölb eine befreundete Gestalt erblickt, winkt wohl mit weissem Tuch hinauf. Aber kaum hat man den Gegengruss aufgefangen, so ist der Beckenhof verschwunden, und wie das Leben im Zauberstrahl der Jugend eilt der Nachen weiter und weiter, vorbei an schönen Fabrikgebäuden, die rechts und links am Ufer stehen, wo Kattun gedruckt, geklopft und in der Limmat reingewaschen wird.
Der Kirchturm von Wipkingen, der aus Obstbäumen hervorragt, ist schon hinter uns. Links zeigt sich der Hardturm, früher auch Schwedenturm genannt, wo vor Zeiten eine Brücke stand, deren Zoll den Freiherren von Regensberg gehört hatte. Als am 24. Heumonat 1343 die angeschwollene Limmat den Gasthof zum Schwert und mehrere Mühlen aus Zürich wegschwemmte, zertrümmerten diese die Brücke, und die Regierung verordnete, dass von nun an zwischen dieser Stadt und Baden keine Brücke mehr solle errichtet werden. Als Herzog Albrecht im Jahr 1352 Zürich von der östlichen Seite belagerte und dort wenig ausrichtete, beschloss er, die Stadt von der Sihlseite anzugreifen, und liess zu diesem Ende wieder eine Brücke gegen den Hardturm schlagen. Die Zürcher aber zerstörten dieselbe durch Flösse, welche sie auf der Limmat hinabschwimmen liessen, und seither ist keine mehr hier gestanden. Jetzt stellt in friedlichern Zeiten eine Gesellschaft agronomischer Freunde in dieser Gegend auf zürcherischem Stadtgemeindeboden fellenbergische Experimente an und benutzt den Turm als Landsitz.
Die südliche Seite des anmutigen Hönggerbergs ist auch schon zurückgetreten. Die Kirche von Höngg winkt vergebens auf ihrem Rebhügel, wir haben jetzt nicht Zeit, dort vom Friedhof die herrliche Aussicht zu bewundern. Der Strom zieht uns vorbei an den Getreide- und Pulvermühlen, vorbei an den reizenden Wiesen, Obst- und Weingärten, an schattigen Wäldchen, an Landhäusern und malerischen Hütten unter alten Nussbäumen, von Weiden umzäunt. Da kommen wir an eine Stelle beim Landsreinwuhr, wo die Limmat sich nach links biegt. Es liegen Steine im Wasser, die Wellen schäumen und spritzen. «Ist das der Kessel?», rufen die Kinder. Aber sie haben kaum gefragt, sind wir schon vorbei. Es war nur ein Vorspiel dessen, was weiter unten auf uns wartet.
Читать дальше