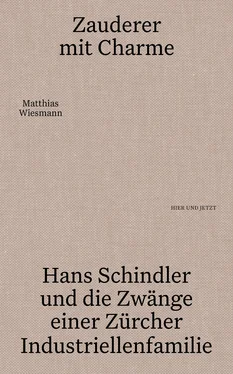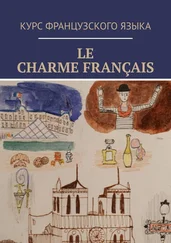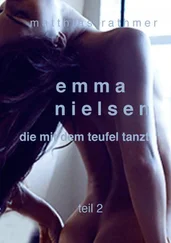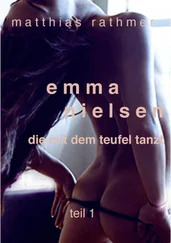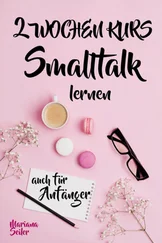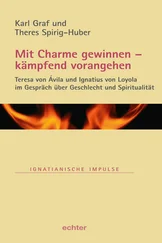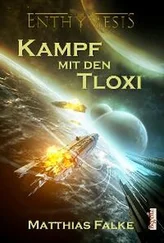Im Frühling 1935 eskalierte die Situation bei der MFO, als Dietrich Schindler direkt mit den Bürochefs des Verkaufs über ein neues Preiskalkulationssystem verhandelte, ohne F. E. Hirt miteinzubeziehen. Hirt reichte in der Folge ein Rücktrittsgesuch ein, weil er seine Autorität als Direktor untergraben sah. Er stellte in Aussicht, bei der MFO zu bleiben, wenn er endlich jene Kompetenzen erhalte, die Direktoren in allen anderen Unternehmen auch hätten. Der Verwaltungsrat griff nun vermittelnd ein und versuchte die unterschiedlichen Positionen zu ergründen. Dietrich Schindler reagierte in einem Brief an seinen Schwager, den Verwaltungsratspräsidenten Max Huber, pikiert auf die Kündigungsandrohung. Hirt sei nicht zur Sparsamkeit erzogen, habe nie etwas Schöpferisches geleistet und trage Mitschuld am technischen Vorsprung der BBC. Hirt wolle «Herr und Meister» in Oerlikon werden, wie er es in der Tochterfirma in Frankreich gewesen sei. Dietrich Schindler schlug stattdessen vor, seinen Sohn Hans zum Direktor zu ernennen.
Hans Schindler hingegen sah im drohenden Weggang von Hirt einen schweren Verlust für die MFO. Er sei der Einzige, der neben dem Generaldirektor «in kommerziellen Dingen» auf der Höhe sei. Gegenüber dem ehemaligen Generaldirektor Behn erklärte er, «dass durch die fortschreitende Unterdrückung u. zermürbende Fesselung der Direktoren u. Angestellten die praktischen Geschäfte u. technischen Fortschritte immer mehr gehemmt u. gelähmt werden». Es gebe immer mehr Anzeichen für einen Niedergang. Man verliere Kunden, und die Produkte könnten mit der Konkurrenz nicht mehr mithalten. «In früheren Zeiten seien die Härten des Führers wiederholt durch die Anerkennung der Erfolge seiner überragenden Klugheit u. Energie entschuldigt worden, in letzter Zeit fehlen solche Erfolge u. der Eigensinn nimmt zu, bis in die geringfügigsten Fragen.» Hans Schindler schlug vor, dass er nach einem Rücktritt seines Vaters die Funktion eines Generaldirektors ausüben könnte.
Im August 1935 traf sich der Verwaltungsrat mit Dietrich Schindler. Dieser konnte dazu überredet werden, eine Lösung ohne Entlassung von Hirt zu suchen. Sein Sohn Hans sollte zum Direktor befördert werden und als sein Stellvertreter agieren. Den ausgearbeiteten Vorschlag lehnte Dietrich Schindler nach reiflicher Überlegung jedoch ab und weigerte sich in der Folge, die Führungsstrukturen zu ändern. Verwaltungsrat Eduard von Goumoëns schilderte seine Eindrücke wie folgt: «Mehr und mehr bin ich davon überzeugt, dass eben die Geschäftsführung des Papa Schindler nicht mehr den Verhältnissen entspricht, wobei ja ohne weiteres zuzugeben sei, dass auch Herr Hirt, und sogar sein Sohn, viele Fehler begehen, aber das Zeug ist durch den Despotismus der letzten Jahre wahrscheinlich noch erst recht verfuhrwerkt worden.» Als eine Delegation des Verwaltungsrats mit Dietrich Schindler neue Vorschläge besprechen wollte, erklärte dieser seinen vollständigen Rücktritt, liess sich später aber überreden, wenigstens im Verwaltungsrat zu verbleiben.
Schliesslich beschloss der Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 23. November 1935, Werner Schindler zum Vizedirektor und Hans Schindler zum Direktor und Präsidenten der neu gebildeten Direktion zu ernennen. Die Direktion musste die Beschlüsse allerdings einstimmig fassen und sich ansonsten an Dietrich Schindler wenden, der das strittige Geschäft dann in den Verwaltungsrat einbringen sollte. Trotz dieser Lösung war Dietrich Schindler am Ende verbittert, weil er in seinen Augen «aus der MFO herausgeschmissen wurde». Die Kündigungsandrohung von Hirt habe am Ende zu seiner Entlassung geführt, während Hirt in seiner Stellung bestätigt worden sei. Er leite de facto heute die Maschinenfabrik. Interessanterweise weist auch Hans Schindler in seiner Autobiografie auf diesen Umstand hin: «Von 1936 bis 1949 liess ich Hirt de facto, allerdings nicht de jure, als spiritus rector walten.»
Führungsvakuum im Gemischtwarenladen
Nur ein Jahr nach seinem Rücktritt als Generaldirektor starb Dietrich Schindler 1936. Die MFO aber befand sich fortan in einem strukturell bedingten Führungsvakuum. Hans Schindler war zwar in die Stellung seines Vaters nachgerückt, doch er führte die Direktion weder formell noch faktisch. Die Unterstellungs- und Verantwortungsverhältnisse waren sehr unübersichtlich. Drei von vier Direktoren trugen formell noch den Titel eines Vizedirektors. Zudem waren sie laut Anstellungsvertrag eigentlich direkt dem Verwaltungsrat unterstellt. Die 1939 vorgenommene Analyse der Unternehmens- und Betriebsführungsebene brachte diese Führungsprobleme klar zum Ausdruck. Als Reaktion wurden die fehlenden Managementfunktionen aufgebaut. Dazu gehörte ein Kontrollapparat mit Kostenrechnungs- und Budgetierungssystem, der dem Direktionsbereich von Werner Schindler mit Einkauf und Finanzen angegliedert wurde. Er konnte sich allerdings mit diesen Controlling-Instrumenten nie richtig anfreunden. Bei der Verkaufsdirektion richtete man ein Büro für Marktforschung ein, um eine systematische Analyse einzelner Produkte vorzunehmen. Die wichtigste Neuerung aber war die Schaffung einer Managementfunktion Personal, die mit Rudolf (Rudi) Huber besetzt wurde, dem Enkel des Gründers Peter Emil Huber und Sohn des Verwaltungsratspräsidenten Max Huber. Rudolf Huber hatte am MIT in Boston Betriebswirtschaft studiert und Einblick in amerikanische Unternehmen erhalten. Er legte besonderen Wert auf die Einführung einer lebendigen und attraktiven Betriebsgemeinschaft und auf gewisse Mitsprachemöglichkeiten des Personals.
Die Analyse des Betriebs ergab noch ein anderes Problem: Die MFO war mit ihrer Produktpalette viel zu breit aufgestellt. Doch welche Sparte sollte man aufgeben? Hans Schindler stellte gegenüber dem Verwaltungsrat fest, dass «alle unsere Branchen [Abteilungen] eigentlich gleich schlecht» seien. Nichtsdestotrotz hatte man sich in allen Bereichen grosses technisches Können angeeignet, das man nicht einfach wieder hergeben wollte. In den Hauptabteilungen Elektrische Kraftzentralen und Elektrische Traktion waren eine Vielzahl von Einzelprodukten notwendig, die eng miteinander verknüpft waren. Die Abteilung Transformatoren und Kleinmotoren erzielte einen konstanten Inlandsabsatz und damit eine wertvolle Grundauslastung. Es kam letztlich nur zu kleinen Flurbereinigungen, indem etwa der Kranbau aufgegeben wurde. War ein Artikel nicht mehr leistungsfähig, sollte er nicht fallen gelassen, sondern durch Weiterentwicklung wieder konkurrenzfähig gemacht werden. Zudem galt es, neue Absatzgebiete und neue Anwendungen zu finden. Der Reduktionsversuch scheiterte in dieser Phase und auch später am Widerstand der Direktbetroffenen. Die Durchsetzung hätte eine sehr harte unternehmerische Hand bedingt, die weder in der Geschäftsleitung noch im Verwaltungsrat vorhanden war. Die zögerliche Haltung spiegelt aber auch das Grundproblem der MFO zu dieser Zeit wider: Die Firma stand technisch in keinem Bereich an der absoluten Spitze, und sie konnte sich nirgends als klare Preisleaderin positionieren. Es fehlten also die Verkaufsschlager, deren Forcierung bei der Aufgabe einiger anderer Produkte eine Umsatzreduktion hätte kompensieren können.
Tat sich die Geschäftsleitung schwer, wären Impulse vom Verwaltungsrat umso nötiger gewesen. Mit Max Huber war das Präsidium allerdings mit einem Mann besetzt, der die Reorganisationsbemühungen zwar unterstützte, jedoch keine neuen Ideen und Konzepte einbrachte. Er beschränkte sich auf die moderierende Rolle des väterlichen Beraters der Unternehmensleitung, die mit drei jungen Familienmitgliedern, seinem Sohn und zwei Neffen, besetzt war. 1944 übernahm mit Alfred Stahel-Hanhart ein Aussenstehender das Verwaltungsratspräsidium. Er starb allerdings bereits 1946 und konnte so wenig bewirken.
Читать дальше