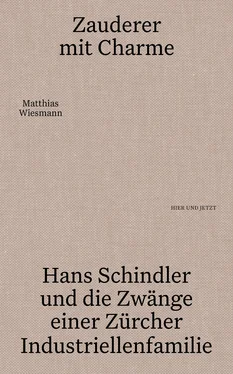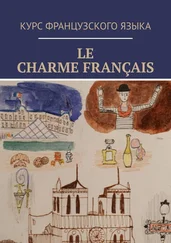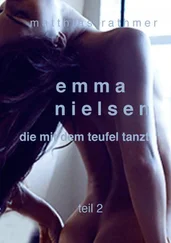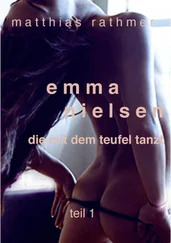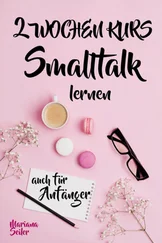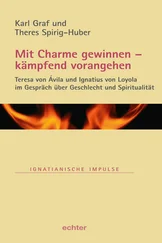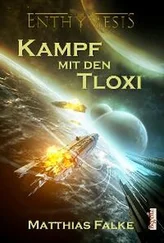Das Fazit einer letzten Besprechung mit den Chinesen fiel ernüchternd aus. Man war übereinstimmend der Meinung, dass man unter den herrschenden Verhältnissen nicht mehr erreichen konnte. Die Regierungsprojekte für hydraulische und thermische Kraftanlagen waren noch nicht reif für eine Auftragserteilung. Auf Schweizer Seite haperte es abgesehen vom Fehlen eines Schweizer Gesandten mit der Kreditvergabe. Weitere Verhandlungen wurden als zwecklos erachtet, da die Regierungsstellen allesamt mit dem Umzug nach Nanking beschäftigt waren. Auch den Geschäften der MFO war kein Erfolg beschieden: Die Offerte für fünf Motoren für eine Getreidemühle war wesentlich höher als die einer englischen Firma. Trotz Rabatten ging der Auftrag verloren. Und ein anderer Industrieller schlug im letzten Moment auch noch eine Transformatorenofferte aus.
Am Abend vor dem Abflug war die Delegation noch zu einem sogenannten schwarzen Kaffee beim Vorsteher der Politischen Abteilung des Ministerpräsidenten eingeladen. «Der schwarze Kaffee besteht aus etwa 5–10 kalten Platten, darunter Rieseneier, die mit Zucker gegessen werden, normalen Hühnereiern und präparierten (sog. faulen) Eiern. Nachher kommt eine Schicht süsser Platten, das ganze übergossen von sehr viel süssem und daneben sehr starkem liqueurartigem Wein.» Doch auch die üppigste Platte konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mission im Grunde kaum zählbare Resultate hervorgebracht hatte.
Am 12. September flog die Delegation vorerst nach Kunming, wo Miao verabschiedet wurde. Er wollte in Schanghai ein Import-Export-Geschäft aufziehen oder für Ingenieurarbeiten in die Mandschurei oder nach Taiwan reisen. Er gab zu, oft gereizt gewesen zu sein, aber das seien alle Chinesen. Er sei nur mit Mühe auf seinem Posten geblieben. Schindler und die übrigen Mitglieder bedankten sich für seine Dienste und anerkannten seinen guten Willen und seinen Einsatz. Der gesamten Delegation hatten das feuchtheisse Klima in Chongqing, der grenzenlose Dreck auf den Strassen, die gleichgültige Bedienung und Mahlzeitenzubereitung, die prekäre Strom- und Wasserversorgung sowie das Fehlen von europäischen Zeitungen und Radionachrichten zugesetzt. Mit der Landung in Dinjan im Assam-Tal endete der zweimonatige Aufenthalt auf chinesischem Territorium.
In Kalkutta verpasste die Delegation den Weiterflug mit einem britischen Flugzeug und verbrachte sechs Tage in der indischen Metropole. Schindler nutzte die Zeit zum Ordnen und Vernichten von Akten und machte eine Aufstellung über die Kosten der China-Mission. Für die MFO rechnete er mit Ausgaben von 4800 Franken (entspricht heute rund 25 000 Franken). In Kairo wohnte Schindler dann wieder auf der Luftwaffenbasis. Er blieb noch ein paar Tage in der ägyptischen Hauptstadt, um MFO-Kunden zu besuchen. Die übrige Zeit nutzte er zum Besichtigen einiger Sehenswürdigkeiten. Er sah unter anderem die Grabbeigaben für Tutanchamun und lobte die schönen kunstgewerblichen Gegenstände. Doch das ganze «Mumienzeugs» sei recht makaber und «eine grosse Verirrung des menschlichen Geistes».
Am 29. September flog Schindler über Athen nach Neapel. Einen Tag später ging die Flugreise weiter über Marseille nach Paris. Für die letzte Etappe nahm er den Zug und kam am 1.Oktober 1945 endlich wieder zu Hause in Zürich an. Seine Ehefrau Ilda schrieb in einem Brief an ihre Freundin Sus Öhman, dass ihr Ehemann Hans alles erstaunlich gut ausgehalten habe und blühend aussehe, obwohl die ganze Reise sehr strapaziös gewesen sei. Jedenfalls sei alles hochinteressant gewesen, so ihr Eindruck.
Da Hans Schindler erst am 18. Dezember 1945 nach einem dreimonatigen Unterbruch wieder mit dem Tagebuchschreiben anfing, ist über die Nachbearbeitung der Chinareise relativ wenig bekannt. Die Mission fand jedenfalls im offiziellen Bern Widerhall, als es darum ging, in China endlich die versprochene Gesandtschaft zu errichten. In der Botschaft des Bundesrats vom 7. September 1945 heisst es zur handelspolitischen Bedeutung einer offiziellen Vertretung: «Das grosse Interesse, das unsere Exportkreise an der Wiederbelebung und am Ausbau unserer Handelsbeziehungen mit China haben, geht schon aus der Tatsache hervor, dass Mitte Juli dieses Jahres eine private Abordnung schweizerischer Industrieller sich trotz aller Unzukömmlichkeiten und Schwierigkeiten auf den Weg nach China begeben hat, um mit den massgebenden dortigen Kreisen Fühlung zu nehmen.» Aus weiteren offiziellen Dokumenten geht hervor, dass Hans Schindler als Berater der Behörden in Sachen Wirtschaftsbeziehungen zu China sehr gefragt war. Und auch als Vortragsredner tourte er offenbar durch die Schweiz. Beim Vortrag über die Chinareise an der Generalversammlung der Neuen Helvetischen Gesellschaft im Dezember 1945 wunderte er sich auf jeden Fall, der wievielte seiner Vorträge über China dies wohl gewesen sei. Im März 1946 entsandte die Schweiz mit Henri de Torrenté schliesslich einen Gesandten nach Nanking.
Die Reise nach China machte auf Hans Schindler einen sehr nachhaltigen Eindruck. In seinen Memoiren bezeichnet er seinen Aufenthalt als beträchtliche Horizonterweiterung. Er erlebte, wie man sich als Fremdling fühlt, und begriff gleichzeitig, wie grenzenlos schwierig es ist, das Leben und Denken der anderen Kultur zu verstehen. In wirtschaftlicher Hinsicht blieb die Mission von bescheidener Wirkung. Der erneut aufgeflammte Bürgerkrieg in China band fast alle Ressourcen, der Wiederaufbau stockte. Mit der Vertreibung der Kuomintang-Regierung unter Chiang Kai-shek nach Taiwan durch die Kommunisten gingen ab 1949 auch die Vorteile persönlich geknüpfter Beziehungen ins Reich der Mitte verloren. Es sassen nun Mao Zedong und seine Leute an den Schalthebeln der Macht. An fruchtbare Wirtschaftsbeziehungen mit dem kommunistischen Regime war vorerst nicht mehr zu denken.
Ein hoffnungsvoller Spross
Wer war dieser Mann, der mutig, aber wohl auch etwas voreilig noch mitten im Krieg nach China aufbrach, um für die Schweizer Exportindustrie eine erste Türe zu diesem riesigen Absatzmarkt aufzustossen? Der jüngere Stammbaum von Hans Schindler liest sich wie ein «Who’s who» der einflussreichen Zürcher Familien. Stammvater der Schindler-Familie war allerdings ein Glarner, der erst 1842 nach Zürich kam und hier das Landgut Kreuzbühl erwarb. Dietrich Schindler-Schindler wurde 1795 in Mollis geboren, studierte Recht in Deutschland und war Teilhaber der Textilfirma Jenny & Schindler in Hard bei Bregenz. Bekannt wurde er allerdings in seiner Heimat als Politiker, der massgeblich an der Ausarbeitung der Glarner Verfassung beteiligt gewesen war. Er plädierte als Liberaler insbesondere für die Aufhebung der konfessionellen Landesteilung. 1837 wurde er zum Landammann gewählt und musste zuerst den katholischen Widerstand brechen. Auf Ausgleich bedacht feindeten ihn nun die radikalen Kräfte an, weil er angeblich gegenüber der katholischen Geistlichkeit zu nachgiebig war. Zermürbt stellte er sein Amt schliesslich zur Verfügung und ging nach Zürich. Sein Sohn Kaspar, der Grossvater von Hans Schindler, heiratete 1853 mit Elise Escher, der Tochter von Martin Escher (vom Glas), eine Angehörige des Zürcher Patriziats. Frei von finanziellen Sorgen betätigte sich der studierte Agronom Kaspar Schindler als Philanthrop für gemeinnützige Institutionen und Hilfsaktionen bei Katastrophen. Er sah in der Wohlfahrt breiter Volksschichten die Lösung der sozialen Frage und regte unter anderem Arbeitereigenheime als Grundlage eines gesunden Familienlebens an. Zu seiner Ehre wurde eine Strasse in Zürich Unterstrass nach ihm benannt. Seine Frau Elise war die geborene Gutsherrin: selbstsicher, energisch, intelligent. Sie betonte stets, dass die Seidenbeuteltuchfabrikation, die ihr Mann nebenher betrieb, eigentlich ihr «Gwerb» sei, da von ihrem Vater Martin Escher übernommen.
Читать дальше