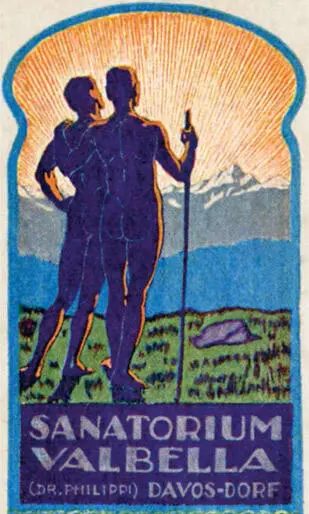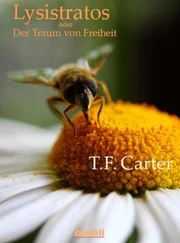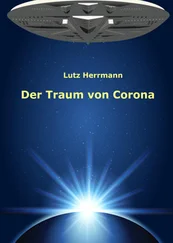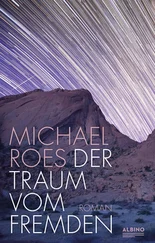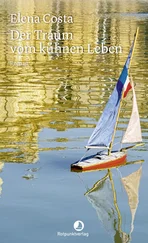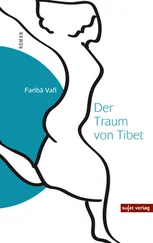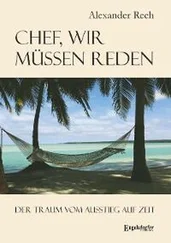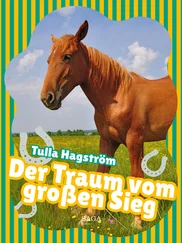Die Entdeckung der Alpen durch Naturforscher und Künstler lenkte auch den Blick von Reisenden aus dem Ausland auf die Alpenregion. Ab 1770 entwickelte sich ein noch bescheidener Fremdenverkehr in der Gegend des französischen Orts Chamonix-Mont-Blanc, welcher von Genf aus aufgesucht wurde. 14In der Folge wurden auch das Berner Oberland und das Wallis Ziel von ausländischen, anfangs vor allem englischen Gästen. Vorerst erschwerten allerdings unterschiedliche kantonale Währungen und schlechte Verkehrswege das Reisen. Die Schweiz begann erst um 1850, später als das Ausland, mit dem Bau von Eisenbahnlinien. 15Leistungen von Alpinisten machten die Alpen weiter bekannt. 161787 hatte der Genfer Horace-Bénédict de Saussure (1740–1799) den Montblanc bestiegen, den höchsten Berg der Alpen, und seine Erfahrungen im vierten Band seines Buches Voyages dans les Alpes, das lange Zeit als Standardwerk für Reisende und Naturforscher galt, veröffentlicht. 17Das goldene Zeitalter des Alpinismus begann in den späten 1850er-Jahren, als der Alpinismus Ausdruck des Wohlstands und des Wunsches wurde, der Klaustrophobie der Städte zu entfliehen. 18Berichte von Pionieren wie Edward Whymper, der 1865 als Erster das Matterhorn bestieg, trugen zur Popularisierung der Alpen bei, später auch die Repräsentation der Berge in der Fotografie. 19Daneben machten die erfolgreichen Reisehandbücher des Londoner Verlegers John Murray den englischen Touristen das Reisen in die Schweiz schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schmackhaft. Murrays Handbücher waren auch Vorbild für den vielfach aufgelegten Schweiz-Führer des Koblenzer Buchhändlers Karl Baedeker, der 1844 erstmals veröffentlicht wurde. 20
Einen weiteren Aufschwung erlebte der Tourismus im Zeitalter der Lokomotiven und Dampfschiffe durch den Reiseunternehmer Thomas Cook. Ab 1863 bot er Pauschalreisen von England in die Schweiz an. Und 1868 schliesslich besuchte auch Queen Victoria zum ersten Mal die Alpen. 21In den 1860er-Jahren, in denen die Theorie des kurierenden Höhenklimas in der Schweiz bekannt wurde, waren die Alpen also bereits ein beliebtes Reiseziel. Graubünden als Ausgangspunkt der Theorie war allerdings zu dieser Zeit – abgesehen vom Engadin – touristisch noch kaum erschlossen. 22Davos und Arosa, aber auch Leysin oder Montana wurden in der Folge auch nicht aufgrund des Tourismus, sondern wegen der Tuberkulose zu bekannten Ortschaften. 23Umgekehrt entwickelten sich die schon früh von Touristen besuchten Ortschaften wie Grindelwald oder Zermatt nicht zu Zentren der Tuberkulosebehandlung. 24Die Einwohnerzahl von Davos stieg von 2000 im Jahr 1870 auf über 8000 im Jahr 1900. Kein Ort in den Alpen mit über 5000 Einwohnern im Jahr 1900 wies ein derart rasantes Wachstum auf. 25Der Höhenkurort entwickelte sich erfolgreich, obwohl die internationale Krise zwischen 1870 und 1890 den Fremdenverkehr in der Schweiz insgesamt hart traf. 26Dabei war es für die Touristen lange kein Thema, die Alpen im Winter zu besuchen, und die ersten Wintergäste im Jahr 1865 waren denn auch Lungenkranke, die in der kalten Jahreszeit in Davos und St. Moritz verblieben. 27In Lungenkurorten wie Davos oder Arosa war es der Zustrom der tuberkulosekranken Gäste, welcher die Nachfrage nach Wintersport entstehen liess. 28So erkannte der lungenkranke Kulturhistoriker John Addington Symonds (1840–1893), welcher 1877 nach Davos gekommen war, im einfachen Schlitten der Davoser ein zweckmässiges Sportgerät. 29
Im 19. Jahrhundert wurde die Alpenregion nicht nur zum begehrten Ziel von Touristen oder Bergsteigern, sondern auch zum Zufluchtsort für Kranke. Dass Kranke damals anfingen, in den Bergen Heilung zu suchen, stand im Einklang mit Vorstellungen der antiken Diätetik, gemäss der zwischen Klima und Gesundheitszustand ein Zusammenhang besteht. Schon Hippokrates von Kos, der als Begründer der Medizin als Wissenschaft gilt, hat im vierten Jahrhundert vor unserer Zeit auf die therapeutische Bedeutung des Aufenthalts- und Klimawechsels hingewiesen. 30Und der griechische Arzt Galen empfahl im zweiten Jahrhundert unserer Zeit frische Luft, erhöhte Gegenden oder Seereisen und Milch für die Behandlung der Tuberkulose. Auch in der Neuzeit suchten Ärzte und Kranke nach dem gesunden Klima. Allerdings existierten unterschiedliche Meinungen darüber, welches nun das vorteilhafteste sei. 31Warme Klimata wurden empfohlen, weshalb Orte an den Mittelmeerküsten von Tuberkulosekranken aufgesucht wurden. 32Auch Schiffsreisen auf dem Meer galten als probates Mittel. 33Und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam das Gebirge dazu. Schon lange bevor Alexander Spengler der Doktrin des heilenden Höhenklimas zum Durchbruch verhalf und den Mythos Davos schuf, wurden das Gebirgsklima und die Alpenluft als heilsam erachtet. Bereits um 1570 hatte der Bündner Pfarrer Ulrich Campell (ca. 1510–1582) festgestellt, dass die Davoser Luft äusserst gesund – «aëris saluberrimi» –, aber auch kalt und rau sei. 34Konrad Gessner hatte 1555 die reine Bergluft empfohlen, und Johann Jacob Scheuchzer bestätigte 1716, dass die Schweizer Luft gesund sei, was etwa dadurch belegt werde, dass die Pest und andere gefährliche Krankheiten selten seien. 35Jean-Jacques Rousseau schliesslich schrieb 1761 in seinem Roman Julie ou la Nouvelle Héloïse, es sei ein allgemeiner Eindruck, «dass man auf hohen Bergen, wo die Luft reiner und dünner ist, leichter atmet, sich leichter bewegt und sich heiteren Geistes fühlt». Er wunderte sich deshalb, «dass die heilsamen und wohltätigen Luftbäder der Gebirge nicht zu den vorzüglichen Heilmitteln der Medizin und der Moral gerechnet werden». 36Friedrich Nietzsche bestätigte 1887 die geistige Wirkung der Höhenluft: In seinem Wohnort Sils-Maria im Oberengadin räsonierte er über das, was dem Philosophen unentbehrlich sei: «eine gute Luft, dünn, klar, frei, trocken, wie die Luft auf Höhen ist, bei der alles animalische Sein geistiger wird und Flügel bekommt». 37
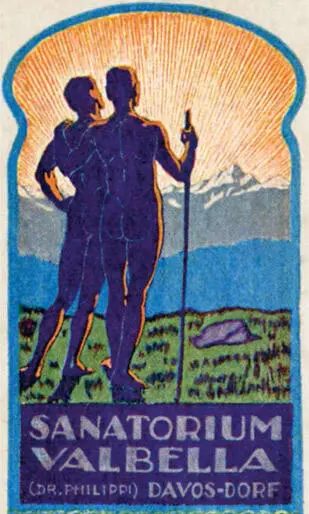
Kleingrafik aus einem Prospekt des Sanatoriums Valbella Davos, um 1915.
Hundert Jahre nach Rousseaus erstem Roman begannen die «heilsamen und wohltätigen Luftbäder der Gebirge» als vorzügliches Heilmittel gegen Tuberkulose zu gelten, worüber diese Arbeit berichtet. Denn auch Mediziner interessierten sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts in zunehmendem Mass für die Berge. Das hygienische Wissen vom Einfluss des Klimas auf die Gesundheit verband sich dabei mit der neuen medizinischen Wissenschaft der Physiologie. 38Physiologen untersuchten auch den Einfluss von Höhenlagen auf die Blutbildung oder die Atmung, wie diese Arbeit zeigen wird. Ab den 1860er-Jahren bot in den Schweizer Alpen eine steigende Zahl selbst ernannter Höhenkurorte ihre medizinischen Dienste an. Dass es gerade Orte in der Schweiz waren, die aufgrund eines als heilsam erachteten Klimas eine führende Stellung in der Tuberkulosetherapie einnehmen konnten, ist auch eine Folge der Entdeckungsgeschichte der Alpen: Die Schweizer Alpen wurden früher beschrieben und erforscht als andere Berglandschaften und galten etwa in Österreich als Vorbild. 39In Graubünden wiederum gab es verschiedene hoch gelegene Orte wie Davos (1560 m ü. M.), Arosa (1800 m ü. M.), St. Moritz (1855 m ü. M.) oder Pontresina (1800 m ü. M), weshalb der Kanton zum Ausgangspunkt der Theorie des heilsamen Höhenklimas werden konnte. 40
Bereits vor der Etablierung von Luftkurorten gab es in der Schweiz Ortschaften, die Heilung versprachen: so die schon im Mittelalter bekannten Badeorte wie Leukerbad und St.Moritz, deren Thermalwasser zum Baden oder zum Trinken verwendet wurden. Badekurorte erlebten um 1800 infolge der verbesserten Verkehrswege einen neuen Aufschwung. 41Andere therapeutische Einrichtungen setzten auf Tropfbäder, Regenduschen oder Abwaschungen. 42Ebenfalls schon vor den Höhenkuren wurden Milch- und Molkekuren zur Behandlung von Lungenleiden angeboten. 43Durch die Kur mit Alpenziegenmolke erlangte die Ortschaft Gais in Appenzell Ausserrhoden im 18. Jahrhundert als Molkekurort Bekanntheit. Teilweise wurde die Molkekur mit der Kuhstallluft-Kur kombiniert. Bei dieser nutzte man die Ammoniakdämpfe des Kuhmistes therapeutisch. 44Auf die Wirkung der Bergluft setzte dann der Schweizer Arzt Johann Jakob Guggenbühl (1816–1863): Er gründete 1841 auf dem Abendberg bei Interlaken im Berner Oberland eine Heilanstalt für Kinder, die an Kretinismus litten, einer damals auch unter Bergbewohnern verbreiteten Krankheit. 45Kretinismus galt als teilweise identisch mit anderen Krankheiten wie Rachitis und Skrofulose. Bei letztgenannter entstellten chronische Entzündungen die Gesichter von Kindern. Sie wurde als tuberkulöse Krankheitsform betrachtet. 46In den 1850er-Jahren beschrieben dann der Freiburger Medizinprofessor Anton Werber in seiner Broschüre «Die Schweizer-Alpenluft in ihrer Wirkung auf Gesunde und Kranke» oder der englische Arzt und Klimatologe Edwin Lee die therapeutische Wirkung der Alpenluft auf Brusterkrankungen und Lungenleiden. 47In dieser Konstellation gelang es dem Davoser Landschaftsarzt Alexander Spengler dank der Unterstützung von anderen Ärzten und von Financiers und Unternehmern, das Davoser Klima als heilsam für Lungentuberkulose zu positionieren. Die Vorstellung, dass der Berg heile, setzte sich durch, und die Höhentherapie der Lungentuberkulose trug ihrerseits zum Bild der «gesunden Berge» und der «gesunden Schweiz» bei. 48Dieses Bild bestand und besteht aus verschiedenen Elementen wie Luft, Höhe, Licht und Wasser. Doch diese gesundheitsfördernden Faktoren wurden nicht einfach in der Natur entdeckt, sie wurden vielmehr durch Zuschreibungen «erfunden» und vermarktet. 49In den Augen des französischen Philosophen und Mediziners François Dagognet korrespondierte das Angebot der Höhenkurorte überdies mit Vorstellungen des Unbewussten der Psychoanalyse: In seinem Aufsatz über die cure d’air von 1959 schrieb Dagognet, dass bereits C.G.Jung auf die Wichtigkeit der Erhebung, des Anstiegs hingewiesen habe. Ebenso erwähnte Dagognet das Streben der Helden der griechischen Mythologie in die Höhe und gegen die Sonne. Es waren laut Dagognet solche Motive des Unbewussten, die Menschen in der frischen Luft, in der Höhe Gesundheit suchen liessen. 50
Читать дальше